Ausgabe: 4/2023
Die Schlussfolgerung aus diesem Panorama – dass Europa nach außen handlungs- und durchsetzungsfähiger werden sollte – ist so offensichtlich, dass kaum ein politischer Akteur an ihr vorbeikommt. Wir haben also kein Erkenntnisdefizit. „Europa muss die Sprache der Macht lernen“, ist einer der Sätze, in denen sich diese Einsicht üblicherweise ausdrückt.
Und die Wirklichkeit? Da bringen in einer aktuellen Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung nicht einmal vier von zehn Deutschen die Europäische Union mit „Stärke in der Welt“ in Verbindung. Das ist kein Zufall. Zwar hat die EU erfreulich geschlossen auf Russlands Angriff auf die Ukraine reagiert. Bei der militärischen Unterstützung für Kiew aber kann Europa auch fast zwei Jahre nach Kriegsbeginn seine eigenen Zusagen nicht einhalten, etwa bei Munitionslieferungen. Und auf eine mögliche erneute Wahl Donald Trumps wären wir nicht viel besser vorbereitet als beim ersten Mal.
Das hat auch damit zu tun, dass europapolitische Debatten zu oft im Ungefähren bleiben und durch wohlklingende, aber oft unrealistische Zukunftsentwürfe und fast schon flehentliche Beschwörungen gekennzeichnet sind, Europa möge doch nun – diesmal aber wirklich – mit einer Stimme sprechen. Gegen langfristige Diskussionen über Grundsätzliches und das Formulieren großer Ambitionen ist nichts einzuwenden. Sie dürfen aber nicht den Blick darauf verstellen, was angesichts der prekären Weltlage Priorität haben muss: eine Politik, die sich auf pragmatische Lösungen und das schnell Machbare konzentriert.
Das gilt auf dem Feld der Verteidigungspolitik. Während Ideen wie die Schaffung einer europäischen Armee so weitreichend sind, dass sie kaum Aussicht auf baldige Umsetzung haben, gibt es einige Bereiche, in denen konkrete Verbesserungen herbeigeführt werden könnten. Das beginnt mit der Erhöhung der militärischen Schlagkraft der Einzelstaaten, wo nicht zuletzt Deutschland nach wie vor weder die Fähigkeiten hat, seiner Schlüsselrolle bei der konventionellen Verteidigung Europas zu entsprechen, noch einen verlässlichen Plan, wie es das in Zukunft schaffen kann. Das geht weiter bei Fragen der Rüstungskooperation, wo es auch an den nationalen Regierungen ist, wenn schon nicht den großen gesamteuropäischen Wurf, dann doch immerhin gemeinsame Rüstungsprojekte zwischen einer begrenzten Zahl von Staaten zu ermöglichen.
Konkrete Fortschritte bei solchen Fragen sind auch deshalb so wichtig, weil sie dazu beitragen würden, jenen Stimmen in Amerika den Wind aus den Segeln zu nehmen, die die enge Bindung der Vereinigten Staaten an die „alte Welt“ vor allem als unnötigen Kostenpunkt sehen. Man kann es nicht oft genug betonen: Die USA „in Europa“ zu halten, wird auf absehbare Zeit das effektivste Mittel bleiben, um unsere Sicherheit zu gewährleisten.
Auch in der Außenpolitik im Allgemeinen führt es nicht weiter, ewig auf den Moment zu warten, in dem eine europäische Politik aus einem Guss über die Welt kommen wird. Europäische Außenpolitik ist und bleibt in erster Linie Außenpolitik der europäischen Staaten – auch wenn eine entschlossene Kommissionspräsidentin die außenpolitische Rolle Brüssels in den vergangenen Jahren stärken konnte, wie Felix Müller in dieser Ausgabe der Auslandsinformationen zeigt.
Eine gemeinsame europäische Außenpolitik scheitert in vielen Fällen einfach daran, dass die Interessen und Einschätzungen zwischen den heute 27 Mitgliedstaaten zu heterogen sind. Seit Langem wird deshalb über die Einführung von Mehrheitsentscheiden in diesem Bereich diskutiert. Tatsächlich würde ein solches Verfahren Entscheidungen erleichtern. Aber: Jeder Mitgliedstaat – auch diejenigen, die in der jüngeren Vergangenheit wiederholt europäische Einigungen blockiert haben – müsste diesem Verfahrenswechsel zustimmen, weswegen er auf absehbare Zeit wohl nicht kommen wird. Und selbst wenn: Möchte die Bundesregierung tatsächlich in außenpolitischen Fragen wie etwa der Haltung zum Krieg in Nahost gegebenenfalls überstimmt werden?
Wir sollten unsere Energie zunächst darauf verwenden, über beständigen Dialog innerhalb Europas so viel Übereinkommen zu erzielen, wie eben möglich ist – und ergänzend dazu gemeinsam mit den Ländern handeln, mit denen die Übereinstimmung am größten ist.
Ein weiteres Feld, auf dem zügiges Handeln erforderlich ist, ist die EU-Erweiterungspolitik. Die Europäische Union hat als Raum der Freiheit und des Rechts auf viele Menschen in ihrer Nachbarschaft nach wie vor Anziehungskraft – selbst oder vielleicht gerade dann, wenn deren Regierung einen völlig entgegengesetzten Kurs verfolgt, wie Jakob Wöllenstein in seinem Artikel zu Belarus verdeutlicht. Man muss aber gar nicht auf die Länder schauen, für die ein EU-Beitritt in näherer Zukunft kein Thema sein wird. Schon die Zahl der tatsächlichen Beitrittskandidaten ist erheblich. Die sechs Westbalkanstaaten stehen seit bald 20 Jahren in der Warteschleife, 2022 haben zudem Georgien, Moldau und die Ukraine Beitrittsanträge gestellt. Dass nun der Prozess insbesondere mit den beiden letztgenannten Staaten in beschleunigtem Tempo vorangetrieben wird, ist richtig. Aber eine solche Entschlossenheit braucht es auch mit Blick auf den Westbalkan. Dass wir auf dem Weg dieser Länder in die EU die strengen Beitrittskriterien nicht derart aufweichen dürfen, dass wir als Gemeinschaft am Ende größer, aber schwächer dastehen, ist unbestritten. Klar ist allerdings auch: Im Erweiterungsprozess der kommenden Jahre sollten geostrategische Erwägungen einen größeren Raum einnehmen als früher, muss es doch unser Ziel sein, dem Einfluss von Staaten wie Russland und China in unserer unmittelbaren Nachbarschaft etwas entgegenzusetzen.
Erheblich für Europas Handlungspotenzial ist auch seine ökonomische Kraft – der Bereich, in dem wir heute noch in einer Liga mit den Vereinigten Staaten und China spielen. Oberstes Ziel europäischer Wirtschaftspolitik sollte daher sein, unseren Kontinent wettbewerbsfähig zu halten. Dabei führt die gerade im linken Spektrum verbreitete Vorstellung, nur eine immer höhere Schuldenaufnahme – am besten noch gemeinschaftlich – ermögliche den nachhaltigen Umbau der europäischen Wirtschaft, in die Irre, wie Tim Peter in seinem Beitrag unterstreicht. Vielmehr ist langfristige finanzielle Stabilität die Voraussetzung dafür, notwendige Investitionen in die ökologische und digitale Transformation auf unserem Kontinent tätigen zu können. Und am Ende kommt es hier wie in so vielen Bereichen auch auf die Mitgliedstaaten an. Es macht einen Unterschied, wer in den europäischen Hauptstädten regiert. Marian Wendt und Eleftherios Petropoulos zeigen das in ihrem Beitrag eindrücklich am Beispiel Griechenlands, das in den vergangenen Jahren die Rolle des wirtschaftlichen Sorgenkinds hinter sich gelassen hat.
Erhebliche Erschütterungen hat seit 2022 die europäische Energiepolitik erfahren. Durch den Ausfall russischer Gaslieferungen stand Europa vor der Herausforderung, seinen Energiebedarf auf anderen Wegen zu decken und gleichzeitig die eigenen Pläne für die Dekarbonisierung des Energiesektors voranzutreiben. Obwohl die EU insgesamt bislang besser durch diese Krise gekommen ist, als man bei deren Ausbruch hatte befürchten müssen, steht sie sich nach wie vor oft durch mangelnde Flexibilität selbst im Weg, wie Veronika Ertl und Philipp Dienstbier in ihrem Artikel zu den Plänen für eine Energiekooperation zwischen der EU und den Golfstaaten zeigen. Die bislang geringe Bereitschaft der Europäer, auch Erdgaslieferungen längerfristig als Teil einer solchen Zusammenarbeit zu betrachten und bei ihren anspruchsvollen Definitionen für kohlenstoffarmen Wasserstoff Abstriche zu machen, hat bis heute keinen einzigen zusätzlichen Kubikmeter nachhaltigen Brennstoffs vom Golf nach Europa gebracht, droht aber, Staaten wie Saudi-Arabien, Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate noch weiter in eine Ausrichtung auf den asiatischen Energiemarkt zu drängen.
Kaum ein Thema hat derzeit in Europa eine solche politische Sprengkraft wie die Migrationspolitik. Migrationsbewegungen nach Europa künftig besser zu steuern, ist – wie Lars Hänsel in dieser Ausgabe zurecht herausstellt – nicht zuletzt deshalb so wichtig, weil wir in den vergangenen Jahren viel zu oft erlebt haben, dass sonst eine der Errungenschaften der europäischen Integration, nämlich die Bewegungsfreiheit der Menschen innerhalb Europas, schleichend abhandenkommt. Wir sollten uns nicht daran gewöhnen, dass ein Zug am ersten Bahnhof nach der deutsch-österreichischen Grenze so lange stehen muss, bis die Bundespolizei die Papiere aller Insassen überprüft hat. Dass die Verhandlungen über eine Reform des europäischen Asylrechts nach Jahren des Stillstands zuletzt vorangekommen sind, ist ein gutes Zeichen. Nun müssen insbesondere jene politischen Kräfte über ihren Schatten springen, die bislang ihren ideologischen Seelenfrieden über die Betrachtung der Realität gestellt haben. Denn wem nützt es, wenn die Parteien der politischen Mitte das Problem so lange ignorieren, bis diejenigen Akteure in Brüssel und in den Mitgliedstaaten noch stärker werden, die ganz gewiss kein Interesse an einem Gleichgewicht zwischen Humanität und Kontrolle haben? Bislang deuten Umfragen darauf hin, dass sich die Kräfte rechts der Europäischen Volkspartei weiter im Aufwind befinden, wie Olaf Wientzek in seinem Beitrag verdeutlicht.
All diese Betrachtungen sprechen nicht dagegen, sich Gedanken über langfristige institutionelle Reformen der Europäischen Union und Wege zu einem einheitlicheren Auftreten Europas zu machen. Bis wir aber die Goldrandlösungen gefunden haben – falls wir sie jemals finden sollten –, müssen wir uns daran machen, die vielen kleinen, weniger glamourösen, dafür aber rasch machbaren Dinge zu tun, die es uns erlauben, in einem ungemütlichen globalen Umfeld zu bestehen. Dabei wird Europa ein Kontinent der Vielfalt – auch der Interessenvielfalt – bleiben. Die Debatte darüber, wie wir mit diesen Differenzen konstruktiv umgehen, wo wir sie vielleicht auch einfach einmal stehen lassen können, statt nach einheitlichen Standards zu suchen, ist auch mit Blick auf die Wahlen zum Europäischen Parlament im Frühsommer 2024 zentral.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Ihr
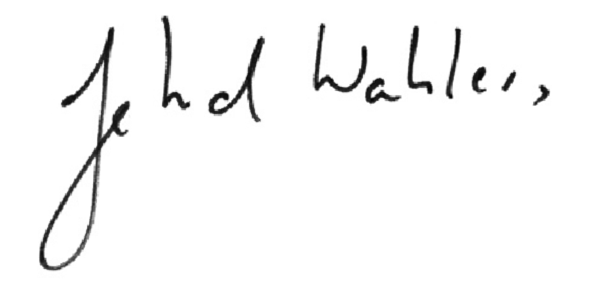
Dr. Gerhard Wahlers ist Herausgeber der Auslandsinformationen (Ai), stellvertretender Generalsekretär und Leiter der Hauptabteilung Europäische und Internationale Zusammenarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung (gerhard.wahlers@kas.de).






