Ausgabe: 3/2022
Unter fragiler Staatlichkeit leiden vor allem die Bewohner des direkt betroffenen Gebiets. Sie werden in ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Entfaltung behindert oder sogar physisch bedroht. Fragile Staaten bergen aber auch Risiken auf internationaler Ebene: Konflikte können sich über Ländergrenzen und Regionen hinaus ausweiten. In einem lokalen Machtvakuum können Akteure Fuß fassen, die auch geografisch weiter entfernte Gesellschaften bedrohen.
Eine solche Entwicklung zeichnet sich derzeit in Westafrika ab, wo vor allem der afrikanische Ableger des sogenannten Islamischen Staats erstarkt. In Ländern wie Mali und Burkina Faso nimmt die Instabilität weiter zu, die staatlichen Strukturen sind viel zu schwach, um der Entwicklung wirksam entgegenzutreten. Und: Die Krise droht auf vergleichsweise stabile Staaten am Golf von Guinea überzugreifen. Es drohen gravierende Folgen: mehr Gewalt, schlechtere Lebensperspektiven, verstärkte Fluchtbewegungen. Anna Wasserfall und Susanne Conrad fordern in ihrem Beitrag daher ein verstärktes deutsches und europäisches Engagement zur Verhinderung eines solchen Szenarios.
Krisenhaft ist die Lage auch im Südsudan – einem Staat, dessen Gründung 2011 noch von großen Hoffnungen begleitet wurde, der in bekannten Fragilitätsrankings jedoch regelmäßig einen der schlechtesten Plätze belegt. Mathias Kamp erörtert, warum der junge Staat in Chaos und Gewalt abgeglitten und kein widerstandsfähiges Gemeinwesen entstanden ist. Er beschreibt die Staatswerdung des Südsudan als „Geschichte des Scheiterns“.
Neben der Durchsetzung des Gewaltmonopols und der Erbringung grundlegender Versorgungsleistungen ist es für die Stabilität eines Staats von Bedeutung, wie legitim er der Bevölkerung erscheint. Ein Staat, in den der Großteil der Bürger Vertrauen setzt und dem er grundsätzlich positiv gegenübersteht, steht auf einem solideren Fundament. Seit dem Militärputsch vom Februar 2021 kann man in Myanmar beobachten, was geschieht, wenn ein Staat diese Legitimität vor seiner Bevölkerung nahezu vollständig verliert. Annabelle Heugas analysiert in ihrem Artikel die Machtübernahme der Junta gleichzeitig als Folge und Katalysator staatlicher Fragilität und zeigt, wie sich viele Menschen seither durch zivilen Ungehorsam und politische Parallelstrukturen gegen die illegitimen Machthaber zur Wehr zu setzen versuchen.
Pavel Usvatov und Mahir Muharemović richten den Blick auf Bosnien und Herzegowina. Auch wenn dieses Westbalkanland in vielen Bereichen nicht als fragil gelten muss, so erschweren ihm rechtsstaatliche Defizite, ein geringes Vertrauen in die Institutionen sowie ethnonationale Partikularinteressen dennoch den Weg hin zu einem gänzlich gefestigten Staat. Hatte das Land nach 1995 zunächst durchaus Fortschritte bei seiner Konsolidierung erzielt, so durchlebt es in jüngster Zeit eine schwere politische Krise, die seine Eliten teils mutwillig herbeigeführt haben.
Staaten können indes auch ohne eigenes Verschulden und trotz grundsätzlicher Leistungsfähigkeit die Kontrolle über Teile ihres Staatsgebiets verlieren. Das musste bereits seit 2014 die Ukraine erfahren, noch bevor die imperialistische Politik Russlands mit der Invasion vom Februar 2022 ihre Existenz vollends infrage stellte. Brigitta Triebel, Hartmut Rank und Daria Dmytrenko zeigen vor diesem Hintergrund, wie in den vergangenen acht Jahren in den sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk, die der Herrschaft des ukrainischen Staats entzogen sind, mithilfe der Justiz ein Willkürsystem „von Russlands Gnaden“ entstanden ist. Sie geben damit zugleich einen Ausblick auf das, was in von Russland neu besetzten Gebieten geschehen könnte.
„In einer eng vernetzten Welt spüren wir Auswirkungen von staatlicher Fragilität, von Krisen und Gewalt auch in Deutschland.“ Dieser Satz stammt aus dem Vorwort der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel zu den 2017 veröffentlichten Leitlinien der Bundesregierung für den Umgang mit internationalen Krisen und Konflikten. Er verdeutlicht einen zentralen Aspekt: Entwicklungen, die manch einem „weit weg“ erscheinen mögen, können Folgen über den eigentlichen Schauplatz hinaus haben. Eine kluge Außenpolitik setzt daher auf Krisenprävention, sie muss aber auch in der Lage sein, auf krisenhafte Zustände zu reagieren und einen Beitrag zur Stabilisierung der Situation zu leisten. Einfach abseits zu stehen ist jedenfalls keine Option – aus humanitären Erwägungen, aber auch aus Eigeninteresse. Es bleibt zu hoffen, dass aus Fehlern, die in der Vergangenheit ohne Zweifel gemacht wurden, jetzt Konsequenzen mit nachhaltiger Wirkung gezogen werden.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Ihr
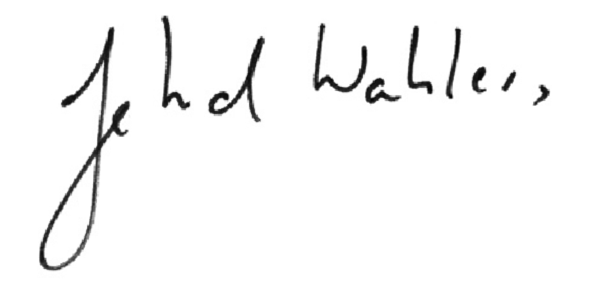
Themen
LDP und Komeito: Japans Regierungsparteien unter Druck
Zwischen Atlantik und Mittelmeer: Marokkos maritime Sicherheitsstrategie
Mexiko: Turbulenter Start in ein richtungsweisendes Jahr
Gibt es Südasien?
Transnistrien ohne Gas und Chişinău im Krisenmodus. Ein schwieriger Winter in der Republik Moldau






