Ausgabe: 2/2024
Liebe Leserinnen und Leser,
es ist die Aufgabe internationaler Wirtschafts- und Finanzorganisationen, auf Entwicklungen hinzuweisen, die die ökonomische Wohlfahrt der Weltbevölkerung beeinträchtigen können. Dementsprechend rechnen diese Institutionen vor, wie groß die Wachstumsverluste durch politisch induzierte Verschiebungen von Wirtschaftsbeziehungen unter diesem und jenem Szenario sein könnten. Diese Risiken sollten wir – natürlich – ernst nehmen. Andererseits: Aufgabe politischer Entscheidungsträger ist es, das große Ganze im Blick zu behalten. Und zu diesem Ganzen gehören neben rein wirtschaftlichen Erwägungen auch viele andere Aspekte, an erster Stelle die Wahrung der Sicherheit und Unabhängigkeit des eigenen Staates und damit der Menschen, die in ihm leben.
Dies gilt umso mehr in einer Welt, in der wesentliche Akteure wie Russland und China nicht zögern, wirtschaftliche Abhängigkeiten anderer Staaten als politische Waffe einzusetzen. Ob es uns also gefällt oder nicht: Deutsche und europäische (Außen-)Wirtschaftspolitik sollte eine neue Balance zwischen ökonomischer und machtpolitischer Logik finden. Mit dieser Ausgabe der Auslandsinformationen wollen wir einen Beitrag zur Diskussion darüber leisten, welche Prinzipien sie dabei leiten sollten.
Sicherheit geht vor Gewinnmaximierung. In den allermeisten Fällen widersprechen sich diese beiden Ziele nicht. Im Gegenteil: Ist unsere wirtschaftliche Basis stark, stärkt das grundsätzlich auch unsere politische Position auf der internationalen Bühne. In solchen Fällen aber, in denen uns die Entscheidungen von Privatunternehmen mittel- und langfristig in die Abhängigkeit von Staaten führen würden, denen wir auf besagter Bühne mit einiger Wahrscheinlichkeit einmal als Gegner gegenüberstehen könnten, darf und soll die Politik eingreifen. Dass es ein Fehler war, beim Weg in die Gasabhängigkeit von Russland nicht nur nicht gegenzusteuern, sondern sie noch politisch zu forcieren, ist heute in Deutschland unter den Parteien der Mitte zumindest die deutliche Mehrheitsmeinung. Nun gilt es, diesen Fehler mit Blick auf die Volksrepublik China nicht zu wiederholen, die laut Experten verglichen mit Russland noch über deutlich größere Möglichkeiten verfügt, uns im Konfliktfall Schaden zuzufügen, da die deutsche und chinesische Wirtschaft in ganz anderer Form miteinander verbunden sind.
So viel Eingriff wie nötig, so viel Freiheit wie möglich. So wichtig das Einschreiten des Staates bei sicherheitsrelevanten Wirtschaftsbeziehungen ist, so wichtig ist, dass er sich bei sicherheitspolitisch unbedenklichen Engagements – und das ist die deutliche Mehrzahl – heraushält. In diesem Sinne plädiert auch Gunter Rieck Moncayo in seinem Beitrag dafür, bei der notwendigen geostrategischen Neujustierung unserer Außenwirtschaftspolitik zielgenau vorzugehen. Die nach dem Zweiten Weltkrieg etablierte liberale Weltwirtschaftsordnung hat zunächst West- und später dann Gesamtdeutschland Wohlstand gebracht. Heute gilt es, innerhalb dieser Ordnung die nötigen Anpassungen vorzunehmen – für die Einhaltung ihrer Regeln einzutreten, ohne dabei naiv zu agieren. Diejenigen aber, die im Windschatten der aktuellen Entwicklungen in Wahrheit Industriepolitik und Protektionismus in großem Stil und um ihrer selbst willen betreiben wollen und damit die Axt an jene Ordnung legen, werden weder unseren Wohlstand noch unsere Sicherheit erhöhen.
Freihandelsgespräche sollten nicht mit anderen Themen überfrachtet werden. Dass wir gefährliche Abhängigkeiten insbesondere von revisionistischen Autokratien reduzieren sollten, ist heute in weiten Teilen der deutschen und europäischen Politik Standardrhetorik. Insbesondere mit Blick auf China sind Begriffe wie „Diversifizierung“ oder „De-Risking“ zurecht in aller Munde. Alternative Wirtschaftspartner werden händeringend gesucht. Zwischen Worten und Praxis aber klafft eine Lücke. Ja: Es werden hier Bundesbürgschaften für das Chinageschäft gestrichen und dort für Projekte in anderen Staaten gewährt. Das ist auch richtig so. Viel stärker aber müsste sich die Politik darauf konzentrieren, bestehende Handelshemmnisse – und das sind heute neben klassischen Zöllen immer mehr nicht-tarifäre Hindernisse – für unsere Unternehmen zu beseitigen und ihnen so ein Engagement in Staaten Südostasiens, Südamerikas oder Afrikas und damit eine Diversifizierung der deutschen und europäischen Lieferketten zu erleichtern oder überhaupt erst zu ermöglichen. Das heißt konkret: Freihandelsabkommen mit den entsprechenden Ländern und Regionen sind schnellstmöglich abzuschließen. Das wäre nicht zuletzt auch deshalb wichtig, weil andere Akteure – natürlich China, aber beispielsweise auch die Türkei oder die Vereinigten Arabischen Emirate – in manchen Weltregionen dabei sind, uns den Rang abzulaufen, wie Lukas Kupfernagel in seinem Artikel mit Blick auf den afrikanischen Kontinent verdeutlicht.
De facto ist die Europäische Union auf diesem Gebiet aber seit Jahren nahezu handlungsunfähig. Dass es selbst zwischen der EU und den USA bis heute kein Freihandelsabkommen gibt, daran hat man sich bereits gewöhnt, was den Umstand aber – zumal in der heutigen Weltlage – keinen Deut weniger bedenklich macht. Aber auch jenseits der etablierten Industriestaaten sieht es schlecht aus. Die mittlerweile 25-jährigen Verhandlungen mit dem südamerikanischen Staatenbund MERCOSUR sind sicher das drastischste Beispiel, ähnlich sieht es aber auch mit Blick auf die Handelsgespräche mit einem aufstrebenden Staat wie Indonesien aus, wie Denis Suarsana in seinem Artikel zeigt.
Neben den wirtschaftlichen Partikularinteressen bestimmter Gruppen in Europa und beim jeweiligen Verhandlungspartner ist es oftmals eine über die Jahre immer stärker gewordene Angewohnheit der Europäer, die die Gespräche erschwert: der Versuch, über Freihandelsabkommen auch handelsfremde Forderungen wie weitreichende Sozial-, Umwelt- und Menschenrechtsstandards durchzusetzen, die auf der anderen Seite des Verhandlungstisches nicht selten als bevormundend und übergriffig empfunden werden. Diese Themen sind zwar fraglos wichtig. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sollten aber andere Wege suchen, sie im Dialog mit ihren Partnern zu bearbeiten. Diese haben wirtschaftlich heute neben Europa andere Optionen und lassen die Handelsgespräche dann im Zweifelsfall eben scheitern. Ergebnis: keine Umweltstandards, kein Freihandel. Wenn wir Europäer den Unternehmen den Markteintritt bei vielen potenziellen Diversifizierungskandidaten dann auch noch durch überbordende Auflagen – siehe Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und die entsprechende EU-Richtlinie – zusätzlich erschweren, beginnt die De-Risking-Rhetorik hohl zu klingen.
Ohne Wettbewerbsfähigkeit keine Konfliktfähigkeit. So wie wir versuchen sollten, unserer Wirtschaft nach außen Hindernisse aus dem Weg zu räumen und keine zusätzlichen Knüppel zwischen die Beine zu werfen, sollten wir ganz allgemein mehr Energie darauf verwenden, sie strukturell wettbewerbsfähiger zu machen. Unsere machtpolitische Stellung auch gegenüber potenziellen Gegnern ist eine andere, je nachdem ob wir wirtschaftlich stark oder abgehängt sind. Und Letzteres droht einzutreten, wenn wir nicht gegensteuern. Sicher: Man sollte sich nicht in Katastrophenszenarien ergehen, denn die wirtschaftlichen Herausforderungen sind auch andernorts immens und große Ambitionen halten nicht immer mit der Realität Schritt, was Philipp Dienstbier und Nicolas Reeves in dieser Ausgabe der Auslandsinformationen anhand der Golfregion veranschaulichen. Und doch sprechen die Wachstumsprognosen für die nähere Zukunft eine deutliche Sprache. Nicht nur steht Deutschland unter den Industrienationen am Tabellenende. Auch könnte Europa den Anschluss an die Vereinigten Staaten und den nordamerikanischen Wirtschaftsraum insgesamt verlieren, der zusehends auch von der dynamischen Entwicklung in Mexiko geprägt wird, wie Hans-Hartwig Blomeier und Maximilian Strobel in ihrem Text darlegen.
Auch bei uns zu Hause in Deutschland und Europa ist also eine Rückbesinnung auf die Stärken unserer freiheitlichen Gesellschaften und Wirtschaftsordnungen – man könnte auch sagen: auf Grundprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft – angesagt: Arbeit und Eigenverantwortung fördern, nicht Abhängigkeit vom Staat; Ressourcen effizient und dezentral einsetzen, nur in Ausnahmefällen durch den Staat zuteilen; und neue Technologien nicht zuallererst als Risiko, sondern vor allem als Chance betrachten, etwa bei der Regulierung Künstlicher Intelligenz.
Es ist fast ein Allgemeinplatz, aber es stimmt: Die Welt ist für Deutschland, Europa und den politischen Westen insgesamt in den vergangenen beiden Jahrzehnten rauer geworden. Und so wie uns diese Rahmenbedingungen in Sachen Rüstung und Verteidigung zu einem Umdenken zwingen, ist dies auch mit Blick auf unsere Wirtschaft der Fall. In beiden Fällen ist die Erkenntnis gerade in Deutschland besonders spät gereift, ein Umsteuern materiell und oft auch intellektuell besonders herausfordernd. Aber in beiden Fällen gilt auch: Mit Realitätsverweigerung und einem „Weiter so“ werden wir absehbar Schiffbruch erleiden.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Ihr
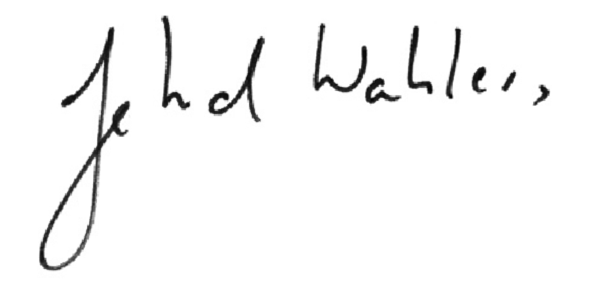
Dr. Gerhard Wahlers ist Herausgeber der Auslandsinformationen (Ai), stellvertretender Generalsekretär und Leiter der Hauptabteilung Europäische und Internationale Zusammenarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung (gerhard.wahlers@kas.de).






