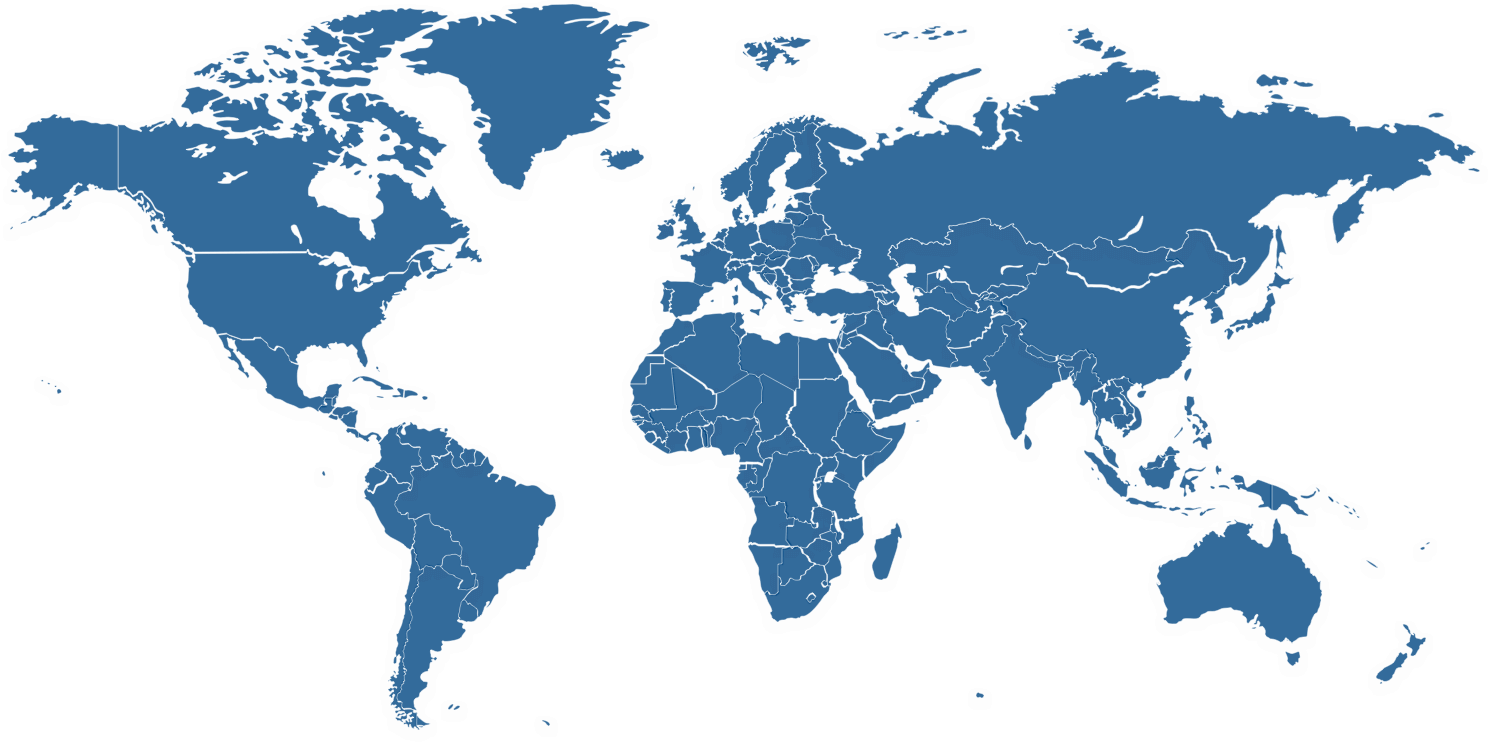Tiefblauer Himmel, strahlende Sonne, ein Sprungbrett – und darunter, statt eines kühlen Schwimmbeckens, ein überdimensionales Glas Apfelwein.
So sieht wohl das Paradies aus für einen echten Frankfurter „Ebbelwoi“-Connaisseur. So jemand ist der Mann, der sich munter hessisch babbelnd neben meinen Tisch in Jens Beckers Apfelweinhandlung stellt. Dabei stört er sich auch nicht daran, dass ich als Berlinerin seinen Ausführungen im Dialekt nur bruchstückhaft folgen kann. Er selbst ist Stammkunde, bezieht hier immer seinen Apfelwein. Mich überrascht das Motiv auf seinem T-Shirt auch nur im ersten Moment, denn mir wird bald klar, dass Apfelwein in Frankfurt mehr ist, als nur ein erfrischendes Getränk.
Diese Vermutung kann Jens Becker nur ausdrücklich bestätigen, der mir kurz darauf, inklusive einer spontanen Weinverkostung, einen Crashkurs zum Thema Apfelwein gibt.
„Apfelwein, das ist eine richtige Kultur“, sagt er.
Als Kelterer und Genießer, dessen Familie seit Generationen mit dem Frankfurter Nationalgetränk Geld verdient, weiß Jens das aus allererster Hand. Er erklärt mir, dass Apfelwein, vor allem im Frankfurter Viertel Sachsenhausen, eine ausgeprägte Geschichte hat. Vor Jahrhunderten befanden sich hier in jeder Straße mehrere Lokale, die ihren eigenen Wein herstellten und ausschenkten. Diese waren besonders Zentren des sozialen Lebens: Wie jeder, den ich an diesem Tag nach der Wirkung des Weins fragen werde, betont auch Jens die kommunikative und gemütliche Atmosphäre, die nach dem Konsum des Getränks in den sogenannten Gartenwirtschaften herrschte und noch herrscht. Auch der Stammkunde, mit dem ich eben schon sprechen konnte, erinnert sich an Abende in seiner Jugend, als er als echter Hesse „in einer schönen Runde“ schon einmal 20 Schoppen, also stolze sechs Liter Apfelwein, zu sich genommen hat.
Wem das hingegen zu viel ist, der kann, am besten in einer kleinen Gruppe, natürlich auch erstmal einen „Gerippten“, also Apfelwein in einem speziell gemusterten Glas, bestellen. Dafür gibt es auch heute noch einige „gemüdlische“ Apfelweinwirtschaften in Sachsenhausen.
Allerdings ist Jens Beckers Apfelweinhandlung nach eigener Aussage die einzige Adresse in Frankfurt, die ihren Wein auch selbst keltert. Dieser ist insofern etwas Besonderes, als dass sowohl Qualität als auch Tradition die ausschlaggebenden Faktoren in der Produktion dieses Weins sind.
Um mir während seiner Ausführungen ein eigenes Bild machen zu können, darf ich zwei Weine probieren. Zuerst einen Jahrgangsapfelwein aus 2015, der wohl die etwas laienfreundlichere Variante darstellt. Er soll dem normalen Rebenwein näher kommen und ich finde tatsächlich, dass er abgesehen von der Apfelnote einem Weißwein ähnelt. Man kann ihn gut trinken. Den zweiten Wein, einen traditionellen Frankfurter „Ebbelwoi“, dessen Herstellung weniger Eingreifen in den natürlichen Gärungsprozess beinhaltet, könne man „nicht einfach so verschenken“. Meiner Meinung nach gibt die Säure und leichte Bitterkeit dem Ganzen etwas frisches, und obwohl es mir in Zukunft eher fern liegen wird, mir zum Frühstück einen 1,2 Liter-Bembel Apfelwein zuzuführen, kann ich den Geschmack nicht völlig verurteilen. Mehrmals werde ich trotzdem davor gewarnt, dass ein ungeübter Gaumen die Säure des Getränks vielleicht nicht zu würdigen wissen könnte, was mir einmal mehr die besondere Beziehung der Frankfurter zu ihrem Apfelwein verdeutlicht. Das und die Ankunft Stellas: sobald sie an der Apfelweinhandlung ankommt, gießt sie sich noch vor der Begrüßung einen Schoppen ein und wird damit Jens‘ Worten zufolge zu einem Sinnbild. „Das ist Stella, sie lebt die Apfelweinkultur“, stellt er sie vor. Mittlerweile hat Jens schon über eine halbe Stunde damit verbracht, mich mit dem Apfelwein bekannt zu machen, und ich fühle mich bereit, selber in die sagenhafte Gemütlichkeit der Gartenwirtschaften einzutauchen.
Was für Fettnäpfchen dort trotzdem noch auf mich warten, werde ich schnell sehen.
Schon bei meiner Bestellung des „Handkäse mit Musik“, einer Art marinierten Harzer Roller, der traditionell zu Apfelwein gegessen wird, benötige ich zunächst die Anleitung der Kellnerin. Sie ist sehr hilfsbereit, ihr Blick ist aber - und nicht nur in diesem Moment, sondern auch, als ihr beim Abräumen auffällt, dass ich meinen Käse mit Messer und Gabel statt auf dem Butterbrot gegessen habe - halb belustigt, halb schon fast persönlich beleidigt.
Doch jetzt will ich es wissen: Was kann ich noch tun, um mich vollends als Touristin zu outen? Also frage ich einige ältere Damen in der Wirtschaft nach einem „süß gespritzten“, also mit Limonade gemischten, Apfelwein. Die Gesichter sind pikiert. „Wie man sowas überhaupt trinken kann, das kann ich nicht nachvollziehen.“ Und trotzdem: Sogar offensichtliche Unwissenheit, die an Kulturfrevel grenzt, führt nicht dazu, dass ich aus der Gesellschaft ausgeschlossen werde. Nein, sie bewirkt vielmehr, dass die Besucher der Gaststätte sich größere Mühe geben, mir ihre Lebensweise näher zu bringen: Es bleibt gemütlich und offen und obwohl ich dafür wohl zu wenig Zeit mitbringe, darf ich dennoch an den Schwärmereien über die großartigen Gespräche teilhaben, die sich in einem Apfelweinlokal unter Einfluss des „Ebbelwois“ für jeden hier einmal ergeben haben. Mit einem guten Gefühl darf ich schlussendlich gehen.
Von Lilli Berger