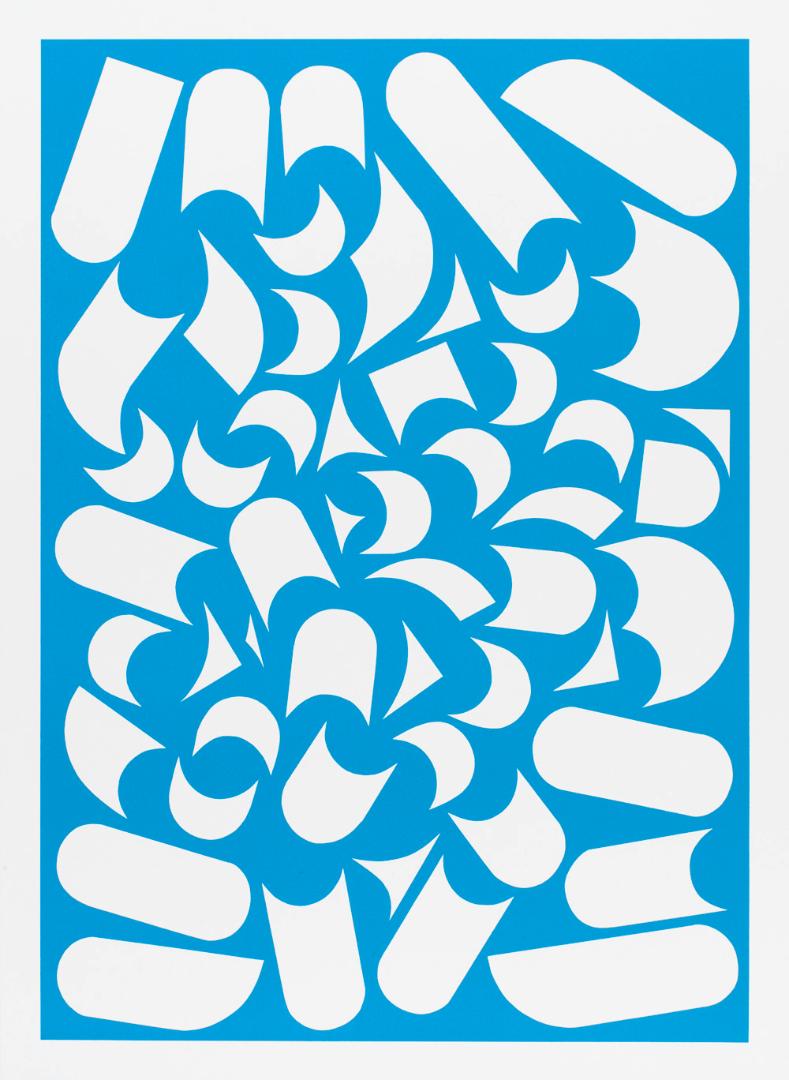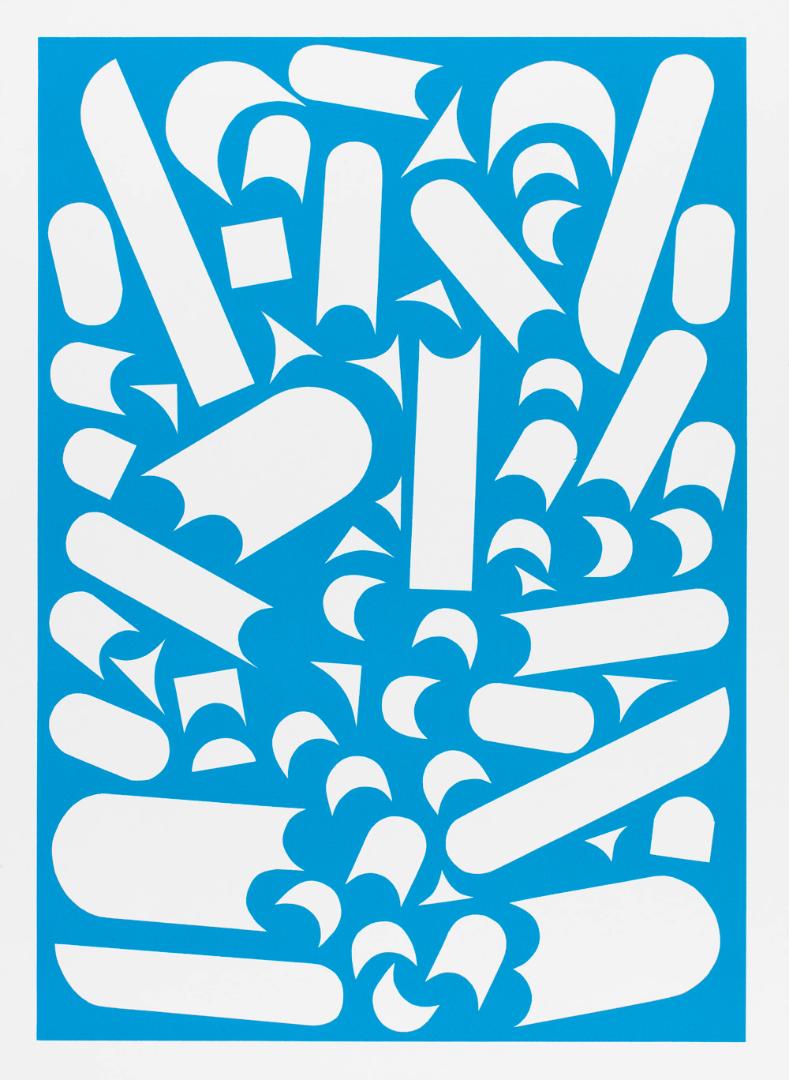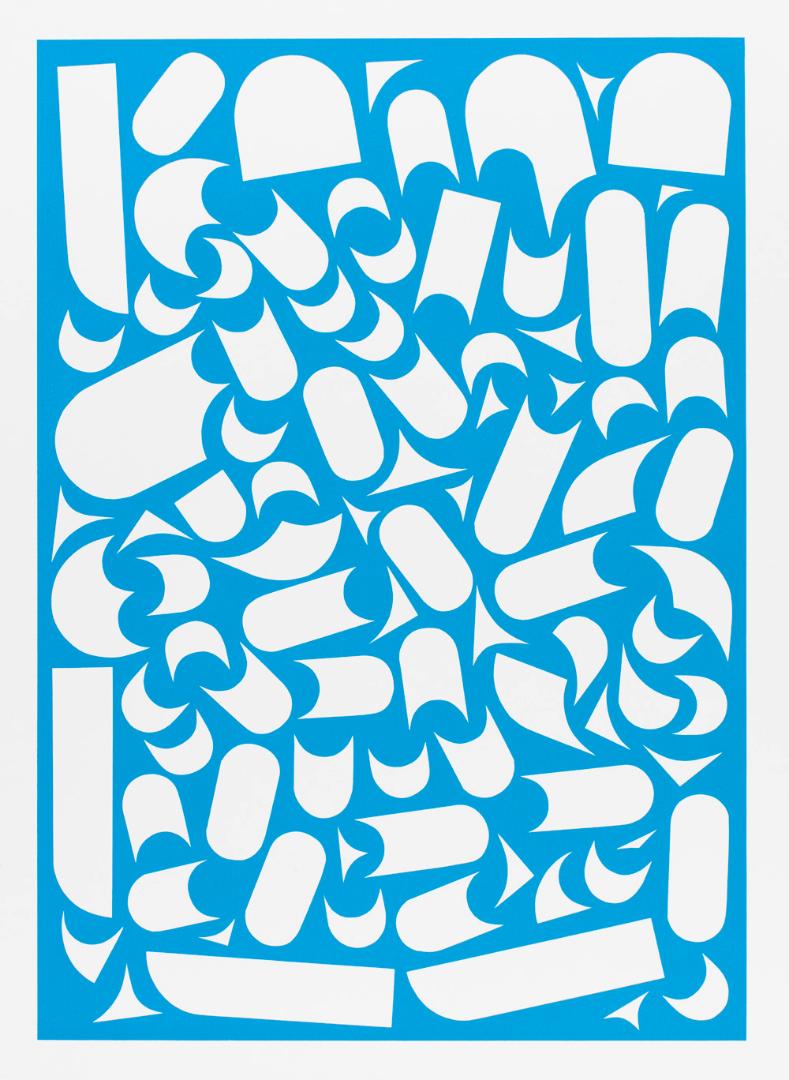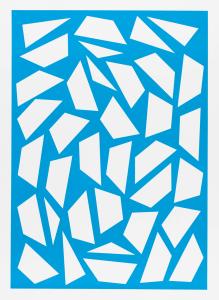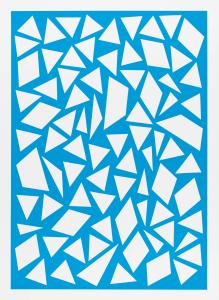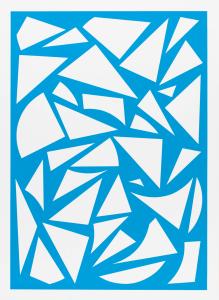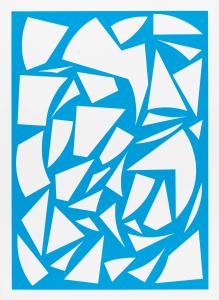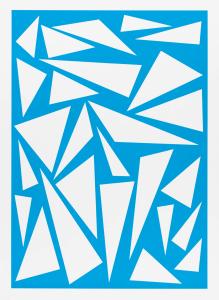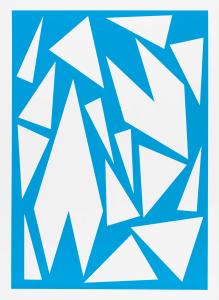Interview mit Franziska Holstein
Berlin, Juli 2016
Kannst Du den Begriff der Position in der bildenden Kunst kurz erklären?
Unter Position verstehe ich eine bestimmte Haltung. Sie ist geprägt durch Herkunft, also dadurch, wann und wo man geboren wurde, durch das Geschlecht, dadurch wie man aufgewachsen ist. Das soziale Umfeld spielt eine Rolle; wo und was man gelernt oder studiert hat. Man macht Erfahrungen, die Auswirkungen haben.
Ist Deine Position etwas, woran du gezielt arbeitest?
Ich denke ja, insofern, als ich mich zum Beispiel durch längere Aufenthalte andernorts vorübergehend aus meinem Umfeld lösen kann. Die Distanz zu Gewohntem verändert die Sicht auf die eigene Tätigkeit. Was das angeht, lasse ich mich gern beeinflussen und suche nach Austausch. Aber während des Arbeitens bemühe ich mich, die Ateliertür zu schließen und alle Gedanken, die mit der Außenwelt, mit Rezeption und einem Betrachter zu tun haben – damit meine ich jeden Betrachter, der nicht ich bin -, auszuschalten.
Du hast bei Arno Rink und Neo Rauch studiert und in den ersten Jahren vor allem figurativ, häufig ausgehend von Familienfotos, gemalt. Wie kam es dazu, dass Du begonnen hast, abstrakt zu arbeiten?
Abstraktion und Gegenständlichkeit sind für mich dicht beieinander. Es wirkt vielleicht so, als gäbe es einen Bruch in meiner Arbeit, mir selbst kommt es eher so vor, als würde sich mein Interesse in Wellen bewegen. Bevor ich angefangen habe zu studieren, gab es abstrakte Arbeiten. Dann gab es eine Phase, in der ich herumgereist bin und gezeichnet habe. Das Zeichnen war später auch Teil des Grundstudiums an der HGB. Beim Zeichnen eines Schädels kann es um das Verstehen und Abbilden des Gegenstandes gehen. Vielleicht brauchte ich aber auch nur eine Beschäftigung. Es hat viel mit Beobachten zu tun. Die Auseinandersetzung mit Form, Farbe, Raum spielt eine Rolle. Es gibt sehr unterschiedliche Themen, die aufgenommen werden können.
Wie funktionieren Referenzen zwischen Bildern in Deinem Werk?
Eine Zeitlang habe ich versucht, Bezüge zu umgehen; jeden Morgen aufzustehen, ein zufälliges Motiv aus einer Zeitschrift zu wählen und abzumalen. Später hat es mich dann im Gegenteil interessiert, mehrere Monate lang meine gesamten Familienfotos motivisch zu durchforsten. Als ich damit fertig war, habe ich nahe Freunde um ihre Familienalben gebeten. Danach war ich auf Flohmärkten auf der Suche nach Fotos. Durch die thematische Setzung hatte ich feste Rahmenbedingungen. Ein Familienbild ist, wie ich es verwendet habe, ein relativ unschuldiges Motiv, es schließt radikale andere Themen aus. Der formale Rahmen war bei diesen Arbeiten noch nicht so streng gesetzt wie bei meinen heutigen, im Grunde aber war es auch damals schon ein serielles Arbeiten.
Es gibt versteckte oder übermalte Motive.
Zu Beginn meiner Meisterschülerzeit habe ich viel produziert, was ich wieder überstrichen habe. So lagerten sich Bilder über Bilder. Diese Schichten fingen an, mich zu interessieren. Aus Zweifel am Bild ist Neugierde geworden. Durch starkes Bearbeiten der Leinwände legte ich darunterliegende Flächen wieder frei. In der darauffolgenden Zeit verwendete ich hauptsächlich Siebdrucke auf Leinwand als Ausgangspunkt. Die wiedererkennbaren und übereinander gemalten Motive wurden durch gerasterte Drucke abgelöst. Familienalben machten Tierbildern Platz. Es gab viel Fell, Panzer, Schuppen, Stacheln und pastos aufgetragenes Acryl.
Du arbeitest in den Serien nicht mit Titeln. Welche Rolle spielt das Material Sprache für Dich?
Die Nummerierungen sind eine Form von Sprache, die präzise formuliert, dass ich Doppeldeutigkeit ausschließe. Der Titel o.T. (203) vermittelt Fakten: es handelt sich um eine 203-teilige Arbeit ohne Titel.
Sollen die Serien nur als Serien gezeigt werden?
Einige müssen komplett gezeigt werden, bei anderen reicht auch ein Teil.
Wann ist eine Serie fertig?
Serien wie o.T. (203), o.T. (52), o.T (68) und o.T. (54) könnten prinzipiell unendlich fortgesetzt werden. Wenn ich mir die Anzahl offenhalten will, notiere ich das im Titel, wie bei o.T. (14ff), da gibt es mittlerweile 22. Die Menge der einzelnen Blätter bei Arbeiten wie o.T. (Blau), o.T. (260) und o.T. (L1 bis 7) ist festgelegt, sie ergibt sich durch ihren Inhalt.
Die einzelnen Werke sind durch verschiedene Regeln miteinander verbunden. Das Bild, seine Form ist Folge einer Handlung. Im Grunde interessiert mich Malerei als Mittel zur Produktion, zur Auseinandersetzung mit formalen Fragestellungen, schreibst Du in Deinem Portfolio. Mich interessieren, die Regeln, die Deine Werke verbinden. Sollen sie dem Betrachter klar sein, sind sie für Dich zentral für das Verständnis des Werks oder existieren sie in der Hauptsache für Dich, im Verborgenen?
Einerseits gibt es innerhalb jeder Serie bestimmte, von mir festgelegte, Einschränkungen; Themen, mit denen ich mich beschäftigen will. Andererseits gibt es ein Regelsystem, wenn ich Elemente und Kompositionen aus einer Serie oder einer Arbeit umwandle, um daraus etwas Neues zu machen. Das sind verschiedene Formen von Übersetzungen.
Beziehen sich diese Regeln immer auf Deine eigene Arbeit, als Kommunikationsvorgang im Rahmen Deines Werks?
Ja. Sie bieten eine Möglichkeit über das Werk zu sprechen, ohne zu stark zu interpretieren. Der Betrachter erahnt, dass es Regeln, eine Struktur zwischen den Bildern gibt. Sie kann, muss aber nicht direkt lesbar sein. Es gibt Serien, wie z. B. o.T. (260), die sich auf ein konkretes Bild beziehen, das ist dem Fall eine Leinwand, o.T. (M1) von 2011. Die 260 Collagen sind eine Art Bildbeschreibung in Form einer neuen Arbeit. Sie zerlegen das ursprüngliche Motiv in seine einzelnen Teile und setzen es wieder neu zusammen. Die meisten Arbeiten, die seit 2009 entstanden sind, besitzen mindestens eine solche Übersetzung. Zu o.T. (M1) gehört in diesem Zusammenhang auch die Lithografie o.T. (L6). Hier geht es um die Teilungsverhältnisse des genannten Bildes. Auch in der 19-teiligen Serie o.T. (Blau) halte ich die Geometrie meiner Malereien systematisch fest. Es geht um die Einzelformen auf den Vor-Bildern und deren Dokumentation innerhalb eines anderen Mediums. Ich wiederhole etwas, ändere den Blickwinkel und entdeckte dadurch Neues.
Eine der Handlungen aus denen Deine Bildserien entstehen, sind Experimente. Du schreibst: Zur Zeit experimentiere ich mit dem Material Farbe. Acryl als dickflüssige Masse. Ich bin Beobachter bei dem was entsteht - abstrakte Farbhaufen, die über den Rand des A3 Papiers drängen, die Formen verselbstständigen sich, die Außenkanten werden unregelmäßig. Ich male beidseitig an diesen Blättern und wie immer seriell, das gibt mir die Möglichkeit einer größeren Intensität beim Arbeiten, ohne zu sehr das einzelne Motiv zu belasten. Wie würdest Du das Verhältnis von Experiment und Kontrolle in Deiner Arbeit beschreiben?
Die Atelierarbeit beinhaltet viel mehr als das, was ich am Ende eines Arbeitsprozesses im Rahmen einer Ausstellung oder auf meiner Internetpräsenz zeige. Dass die fertigen Ergebnisse strukturierter sind als die einzelnen Arbeitsschritte, ist klar – sie entsprechen einer Form, in der ich mich präsentieren will und die ich vorher ausgewählt habe. Typisch für ein Experiment ist das Festsetzen von Rahmenbedingungen, innerhalb derer Dinge ausprobiert werden können. Ich kann nur herausfinden, wie C reagiert, wenn A und B feststehen. Das Finden des richtigen Settings ist Teil des Arbeitsprozesses. Durch die Setzung von Bezugspunkten, ermögliche ich mir das Experimentieren. Meistens ist es so, dass ich nach einer Ausstellung für einige Wochen sehr viel ausprobiere, losgelöst davon, dass ein Produkt entstehen muss. Eine Zeitlang arbeite ich mit dem Wissen, dass nichts entsteht, was andere sehen werden.
Kannst Du genauer beschreiben, was in Deinen Experimenten untersucht wird?
Letztlich geht es immer um mich selbst. Während ich versuche, mich besser kennenzulernen, entstehen Bilder. Es kann bedeuten, dass ich wochenlang meine Atelierarbeit einschränke, mich bewusst reduziere und ausschließlich Papier grundiere, es trocknen lasse, dann die Rückseite zustreiche und den Vorgang wiederhole. Dabei können hunderte Blätter gleichzeitig in Arbeit sein. Quantität ist wichtig, um aktiv zu sein und intuitives Handeln über den Intellekt zu legen, um Fragen vorerst auszuschalten. Durch diese Arbeitsweise kann ich Impulse, die mit Kreativität und Gestaltungswillen einhergehen, sehr klar spüren.
Was wäre für dich die ideale Rezeption?
Wenn jemand dadurch, wie ich arbeite, Lust bekommt, selbst aktiv zu sein. Da spielt Energieaustausch eine Rolle. Mir passiert das eher bei Musik. Da geht es um eine bestimmte Euphorie, durch die ich etwas schaffe, das ein wenig über meine eigenen Grenzen hinausgeht.
Franziska Holstein, geboren 1978 in Leipzig, bildende Künstlerin, lebt in Leipzig. EHF Fellowship der Konrad Adenauer Stiftung 2011.
Katharina Schmitt, geboren 1979 in Bremen, Theaterregisseurin und Autorin, lebt in Berlin und in Prag. EHF Fellowship der Konrad Adenauer Stiftung 2014.
Bilder © Franziska Holstein | Titel Reihe: o.T. 64,6 × 47,2 cm, Handoffset auf Papier
Texte © Katharina Schmitt