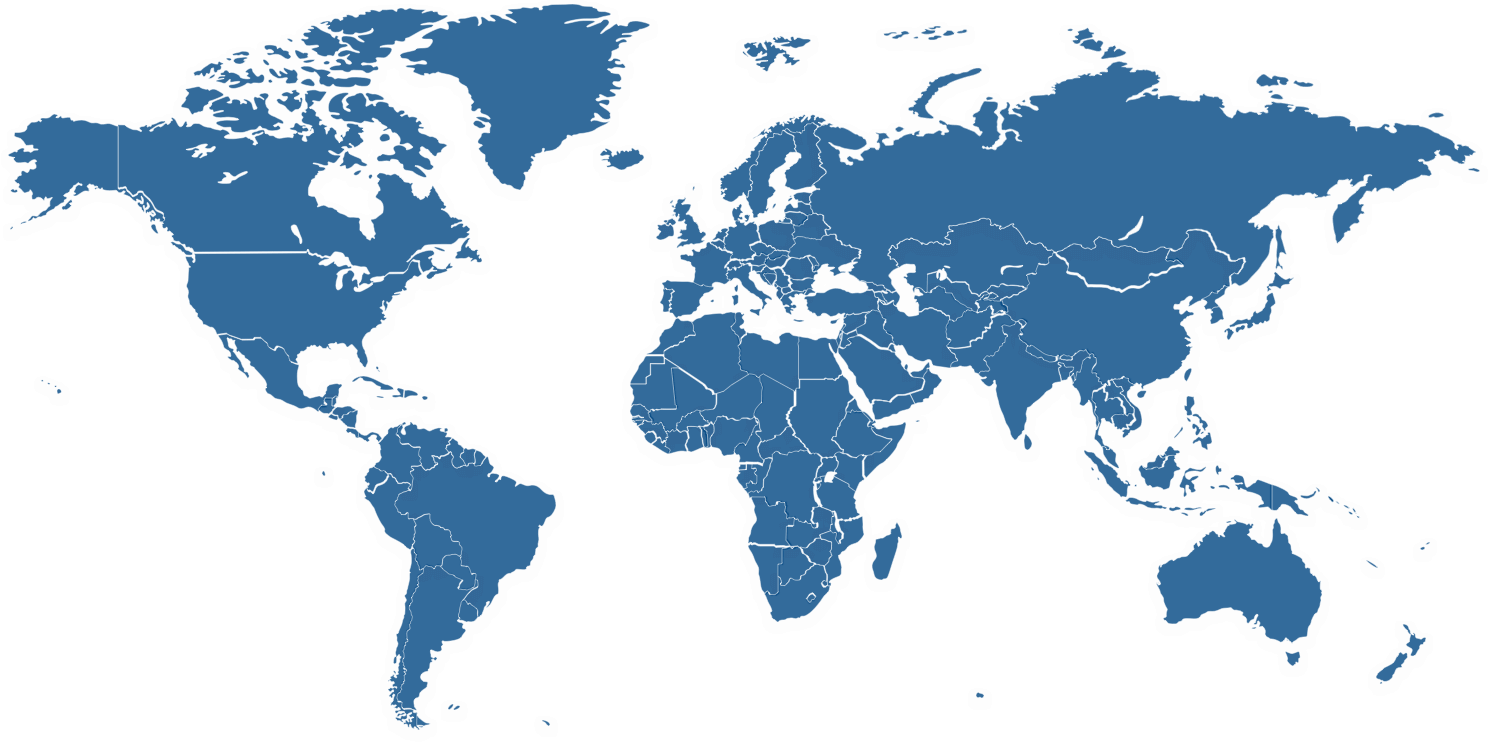Agrégateur de contenus
Kollegiatinnen und Kollegiaten
Agrégateur de contenus
Ayça Akçakoca
Kontextuale Ökonomik und ökonomische Bildung, Universität Siegen; Doktorvater: Prof. Dr. Nils Goldschmidt
Dissertation: „Die Bedeutung ökonomischer Bildung für die gesellschaftliche Integration. Das Verhältnis von ethnisch-sozialer Herkunft und Bildungserfolg“
Abstract:
Der Bildungserfolg ist eine Grundvoraussetzung für die Teilhabe am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben. Dennoch haben viele Menschen in Deutschland, vor allem mit Migrationshintergrund einen erschwerten Zugang zu Bildung. Der erste Teil dieser Arbeit beabsichtigt, soziale Ungleichheiten, die insbesondere im Bildungsbereich entstehen, aufzudecken. Dabei wird vor allem auf eine Inklusion benachteiligter Personengruppen in marktgesellschaftliche Prozesse fokussiert. Im Sinne unserer Wirtschaftsordnung soll die ökonomische Bildung im ersten Teil dieser Arbeit als Teilhabevoraussetzung verstanden werden, das dazu genutzt wird, die selbstbestimmte Gestaltung des Lebens sicherzustellen. In einem zweiten Teil meiner Dissertation soll der Erfolg von Lernspielen als Bildungsinstrument untersucht werden. Das Lernspiel „Good Life for All“ soll dabei als didaktische Methode dienen, auf die tägliche Konfrontation gravierender, globaler und ethnischer Ungleichheiten aufmerksam zu machen. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf den Diskrepanzen zwischen dem Globalen Norden und dem Globalen Süden. Das Lernspiel soll Schülerinnen und Schüler dazu veranlassen, ökonomische Entscheidungen für das Eigenwohl zu treffen, als auch gesamtgesellschaftliche Interessen zu berücksichtigen. Dabei wird der Einbezug konkreter Alltags- und verschiedener Länderperspektiven gewährleistet. Dies bezweckt, dass die Zielgruppen sowohl einen persönlichen Bezug zu den vermittelten Themen herstellen, als auch multiperspektivisch denken. Dieser Ansatz spiegelt die Einsicht wider, dass Probleme mit global vernetzten Ursachen auch global vernetzte Antworten und Perspektiven erfordern.
Jonas Neuhoff
Rechtswissenschaften, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn; Prof. Dr. M. Schmoeckel
Dissertation:
»Die Unabhängigkeit der Deutschen Bundesbank von der Bundesregierung nach dem Bundesbankgesetz von 1957«
Abstract:
Die „Unabhängigkeit“ der Bundesbank von Weisungen der Regierung nach § 12 S. 2 des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank vom 26. Juli 1957 und das Verhältnis zwischen Bundesbank und Bundesregierung waren zentrale Diskussionspunkte im Gesetzgebungsverfahren. Diese „Unabhängigkeit“ wurde zudem immer wieder in Frage gestellt, beispielsweise im Zuge der Entwicklung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu einer Wirtschafts- und Währungsunion. Für die Arbeit werden Gesetzgebungsmaterialien (Parlamentsarchiv des Deutschen Bundestages) und Archivmaterial aus dem Bundesarchiv im Koblenz für die Arbeit der Bundesregierung sowie des Bundesministeriums der Finanzen und des Bundesministeriums für Wirtschaft bis 1957 ausgewertet. Darüber hinaus sind neben Monografien, Artikeln in Fachzeitschriften und anderen zeitgenössischen Veröffentlichungen Diskussionen in Fachgremien, unter anderem im Zentralbankrat der Bank deutscher Länder, von besonderer Bedeutung.
Tobias Romey
ESCP Business School Berlin, Lehrstuhl für internationales Management und strategisches Management; Prof. Dr. Stefan Schmid
Dissertation:
»Exploring the CEO-CFO pay gap - the influence of celebrity and power status«
Abstract:
Die Frage, wie sich Machtunterschiede im Top-Management auf Gehaltsunterschiede auswirken, ist seit langem ein zentrales Thema der Management Forschung. Frühere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Machtunterschiede im Top-Management zu Gehaltsunterschieden führen können. Dabei geht es nicht nur um die Macht der Position, sondern auch um die Macht, die beispielsweiße durch das Netzwerk und die Beziehungen von Top-Managern aufgebaut wird. Diese kann dazu führen, dass Top-Manager mit mehr Macht höhere Gehälter erhalten als ihre Kollegen. Darüber hinaus stellen wir die Frage, ob die Prominenz (Celebrity) von Top-Managern diesen Zusammenhang beeinflussen kann. Celebrity von Top-Managern ist ein relativ neues Forschungsgebiet, das sich auf die Tatsache bezieht, dass einige Top-Manager in den Medien besonders präsent sind und eine gewisse Prominenz genießen. Wir gehen davon aus, dass diese Prominenz auch den Zusammenhang zwischen Machtunterschieden und Gehaltsunterschieden beeinflussen kann.
Yannik Jakob
Technische Universität Chemnitz; Doktorvater: Prof. Dr. Stefan Korte
Dissertation:
»Die Besteuerung der Digitalwirtschaft - Eine Kritische Würdigung des OECD/G20 Vorschlags zu Pillar One aus unionsrechtlicher und steuerlicher Sicht«
Abstract:
Getrieben von einem fortlaufenden Anstieg von Internetnutzern wurde der Börsenkurs von Digitalunternehmen beflügelt, die von einem Rekordumsatz zum anderen eilen. Um die Folgen von diversen Krisen (z. B. COVID-19 Pandemie) zu bewältigen, befinden sich Staaten fortlaufend auf der Suche nach neuen Einnahmequellen. Hierzu haben sich im Oktober 2021 über 130 Staaten auf ein neues Besteuerungskonzept (Two-Pillar Solution) verständigt. Im Rahmen von der ersten Säule (Pillar One) wird u. a. die Neuverteilung von Besteuerungsrechten (Amount A) forciert. Insbesondere die Digitalunternehmen sollen künftig in den Staaten auch Steuern zahlen, indem sie bestimmte Umsatzschwellen überschreiten, jedoch bis dato keinen steuerlichen Anknüpfungspunkt begründen. Dies wirft eine Vielzahl von offenen Fragen auf, die in drei Forschungsfragen gebündelt werden können:
- Untersuchung von Pillar One aus unionsrechtlicher Sicht
- Untersuchung von Pillar One aus steuerlicher Sicht
- Untersuchung von Pillar One im Lichte der Tax Compliance aus Sicht eines deutschen Rechtsanwenders
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um ein interdisziplinäres Dissertationsthema, sodass rechtswissenschaftliche sowie wirtschaftswissenschaftliche Aspekte diskutiert werden.
Justus Rauwald
Geschichtswissenschaften, University of Cambridge, GB, Fitzwilliam College; Doktormutter: Dr. Sylvana Tomaselli
Dissertation:
»Adam Smith on inequality (Arbeitstitel)«
Abstract:
Adam Smith is widely regarded to have defined the ideological origins of capitalism with his masterpiece Wealth of Nations. However, his contribution to the debate on inequality in society is seldom considered. Istvan Hont and Donald Winch, the pioneers of modern Smith scholarship, have argued that Smith was uninterested in inequality and more concerned with fairness and poverty. Although this view remains dominant, there have been piecemeal studies of his ideas on inequality. However, no one has considered inequality’s role in Smith’s thought holistically. By contrast, my project analyses Smith’s oeuvre through the prism of inequality and will show that he was concerned with different inequalities, their origins and effects, and potential solutions. This could shed new light on Smith’s political economy and its relationship with his wider thought. As Smith is regarded as a foundational figure in liberal thought, this project could challenge interpretations of liberal thought and the relationship between inequality and free markets.
Daniel Rühmann
Rechtswissenschaft, Institut für Völkerrecht und Europarecht, Georg-August-Universität Göttingen; Doktorvater: Prof. Dr. Dr. h.c. Peter-Tobias Stoll
Dissertation:
»International Reforms on State Enterprise Regulation – New Perspectives from Preferential and National Developments«
Abstract:
Der zunehmend „strategische“ Gebrauch von Staatsunternehmen stellt eine Herausforderung für die wettbewerbswirtschaftlich und marktwirtschaftlich organisierte Weltwirtschaft dar. Die rechtliche Behandlung von Staatsunternehmen im Recht der WTO, in Freihandelsabkommen und im Völkergewohnheitsrecht ist im Regelungsansatz sowie im Geltungsbereich fragmentiert. Die Instrumente des internationalen Handels- und Wettbewerbsrechts bedürfen der Reform, um den Herausforderungen durch Staatsunternehmen begegnen zu können. Die Dissertation möchte die bisher auf die tradierten internationalen Regeln konzentrierte Reformdiskussion im Kontext vergleichbarer Regelungen in nationalen Wirtschaftsordnungen betrachten. Besonders Australien verfügt über erfolgreiche Erfahrung in der Regelung und Privatisierung von Staatsunternehmen mit dem nunmehr auch international beachteten Ansatz der Wettbewerbsgleichheit. Ebenso bieten die rechtlichen Instrumente im Binnenmarkt der Europäischen Union auf internationale Problemstellungen übertragbare Ansätze.
Victor Schauer
Ludwig-Maximilians-Universität München; Doktorvater: Prof. Dr. Christian Hofmann
Dissertation:
»Real Effects of Transparency Regulation«
Abstract:
In meiner Dissertation mit dem Titel “Real Effects of Transparency Regulation” untersuche ich, welche realen Effekte Transparenzregulierung auf Unternehmen und die Gesellschaft hat. Transparenzregulierung beschreibt die verpflichtende Veröffentlichung von Informationen, die nicht nur den Shareholdern eines Unternehmens dienen, sondern die Informationsinteressen eines breiteren Kreises von Stakeholdern, wie Mitarbeitern, Kunden oder der Gesellschaft insgesamt, ansprechen. Reale Effekte entstehen, wenn Transparenzregulierung nicht nur die Berichterstattung der Unternehmen beeinflusst, sondern auch deren Entscheidungen in der Realwirtschaft, wie z. B. die Wahl der Organisationsstruktur (Leuz & Wysocki, 2016). Ich fokussiere mich auf diese realen Effekte, weil sie die Wirksamkeit von Transparenzregulierung und somit den Interessenausgleich der sozialen Marktwirtschaft zwischen Unternehmen und Stakeholdern der Gesellschaft beeinflussen.
Johannes Stark
Kühne Logistics University, Hamburg, Organizational Behavior; Doktorväter: Christian Tröster, Niels van Quaquebeke
Dissertation:
»Wo komm ich her - wo will ich hin? Die organisationale Relevanz von Trajektorien des sozio-ökonomischen Status«
Abstract:
Effekte des sozio-ökonomischen Status, eine Funktion aus objektiven Ressourcen (Einkommen, Bildungsgrad und beruflicher Status) und subjektivem sozialen Status, auf das Verhalten von Menschen in Organisationen und somit auf den individuellen Karrierefortschritt und die Zusammenarbeit in Organisationen gewinnen in der Management-Forschung an Bedeutung. Dabei wurde der sozio-ökonomische Status bisher jedoch als stabiles Merkmal verstanden, während Trajektorien des sozio-ökonomischen Status vernachlässigt wurden. In meiner Forschung strebe ich danach, bestehende theoretische und empirische Widersprüche aufzulösen, indem ich untersuche, wie die Interaktion zwischen der sozialen Herkunft und dem aktuellen sozio-ökonomischen Status beschriebene Effekte beeinflusst. Außerdem beschreibe ich den individuellen und organisationalen Nutzen einzigartiger Erfahrungen, die im Rahmen sozialer Mobilität gemacht werden.
Julius Nigel Velz
Wittener Institut für Familienunternehmen (WIFU); Universität Witten/Herdecke; Doktorvater: Prof. Dr. Marcel Hülsbeck
Dissertation:
»Foundation-owned Family Firms - Why and how do family owners decide for foundation ownership?«
Abstract:
Diese kumulative Dissertation untersucht Stiftungsunternehmen (Foundation-owned firms) und Unternehmensstiftungen (Corresponding foundations) in Deutschland. Mit namhaften Vertretern wie Aldi, Bosch, dm oder Vorwerk stellen Stiftungsunternehmen hierzulande kein Novum dar, erleben aber derzeit eine Renaissance. Dabei sind die verschiedenen Ausprägungen sehr variabel, haben allerdings gemeinsam, dass mit Übertragung von Unternehmensbeteiligungen in eine Stiftung eine „selbstständige Vermögensmasse mit eigener Rechtspersönlichkeit“ entsteht, wodurch der Stifter und dessen Erben das gestiftete Vermögen unwiderruflich abtreten. Das Forschungsvorhaben konzentriert sich auf Familienunternehmen, die Anteile in eine Stiftung übertragen, und untersucht in dem Zusammenhang die Entscheidungsfindung, den Beratungsprozess und das psychologische Eigentum.
Sinan Bariş Yaşar
Rechtswissenschaft, Universität Heidelberg; Doktorvater: Prof. Dr. habil. Dr. h.c. mult. Peter-Christian Müller-Graff, Ph.D. h.c., MAE
Dissertation:
»Die Übernahme aufstrebender Unternehmen im Recht der europäischen Zusammenschlusskontrolle«
Abstract:
Die Doktorarbeit beleuchtet die Problematik der Übernahme aufstrebender Unternehmen (Nascent Acquisitionen) im Recht der europäischen Zusammenschlusskontrolle und deren Auswirkungen auf die Wettbewerbsstruktur. Aufstrebende Unternehmen (Start up Unternehmen) sind junge Unternehmen, deren Produkte oder Dienstleistungen noch nicht vollständig etabliert sind und deren Marktpotenzial daher ungewiss ist. Diese Unternehmen tragen erheblich zur Innovation und Dynamik auf Märkten bei, indem sie neue Ideen und Produkte einführen. Jedoch sind sie aufgrund des hohen Zeit und Kapitalbedarfs für Marketingaktivitäten und mangelnder Erfahrung besonders anfällig für das Verhalten etablierter Unternehmen. Ein zentrales Problem bei der Übernahme solcher Unternehmen ist, dass diese oft aufgrund ihrer geringen Umsätze nicht von Kartellbehörden aufgegriffen werden. Hier besteht Reformbedarf, insbesondere hinsichtlich der Anpassung der quantitativen Umsatzschwellen, um eine wirksame Kontrolle zu ermöglichen. Weiterhin können Maßnahmen wie die Reform der Verweisungsklausel des Art. 22 FKVO und die Einführung einer Anzeigepflicht für Übernahmen durch große Unternehmen helfen, diese Problematik zu adressieren. Zudem wird die Notwendigkeit diskutiert, neue Schadenstheorien wie „Killer Akquisitionen“ und „Reverse Killer Akquisitionen“ stärker in die Bewertung einzubeziehen. Diese Theorien beleuchten die Absicht etablierter Unternehmen, durch Übernahmen potenzielle Konkurrenz zu eliminieren oder die Entwicklung neuer Produkte zu stoppen. Abschließend werden Vorschläge zur Verbesserung der Beweislast und zur effektiveren Erhebung und Bewertung von Nachweisen durch Kartellbehörden vorgestellt, um die Prognoseunsicherheit zu verringern und eine ausgewogene Bewertung von Übernahmen zu gewährleisten. Die Doktorarbeit zielt darauf ab, sowohl theoretische als auch praktische Ansätze zur Reform des EU Kartellrechts bezüglich der Kontrolle von Übernahmen aufstrebender Unternehmen zu präsentieren, um das Wohl der Verbraucher und Innovationen auch langfristig zu fördern.
Theresa Weitz
Technische Universität München; Doktorvater: Prof. Dr. Claudia Peus
Dissertation:
»Karrieren neu denken: Wann und warum entscheiden sich Arbeitnehmer für einen lateralen Jobwechsel innerhalb ihres Unternehmens?«
Abstract:
Hierarchischer Aufstieg galt lange Zeit als einziger erstrebenswerter Karriereweg. Arbeitnehmende, die diesen anstrebten, galten als besonders ehrgeizig – alle anderen als unfähig oder veränderungsunwillig. Praktisch entscheiden sich allerdings Arbeitnehmende immer häufiger gegen einen Aufstieg auf der Karriereleiter und dennoch für einen Wechsel ihrer aktuellen Position. Wann und warum entscheiden sich Arbeitnehmende für einen Wechsel innerhalb des Unternehmens ohne Aufstieg? Angesichts der sich verändernden Beziehung zur Arbeit und der sich wandelnden Arbeitswelt schlage ich eine breitere Perspektive auf die berufliche Karriere vor, die über den engen Fokus von Entwicklung als hierarchischem Aufstieg hinausgeht. Meine Dissertation soll zeigen, dass ein interner lateraler Wechsel ein erstrebenswerter Karriereschritt für Arbeitnehmende sein kann und für Unternehmen eine wichtige Option darstellt, qualifizierte Arbeitnehmende im Unternehmen zu halten. Zunächst wird in diesem Dissertationsprojekt empirisch untersucht, welche Entwicklungsoptionen Arbeitnehmenden zur Verfügung stehen und welche Konsequenzen aus ihnen entstehen. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen entwickelt das Dissertationsprojekt ein Erklärungsmodell für Karriereentscheidungen. Dabei werden sowohl qualitative als auch quantitative Methoden angewandt.
Elisabeth Lindemann
Universität Leipzig; Doktorvater: Prof. Dr. Gregor Roth
Dissertation:
»Das Verständnis von Vermögen und Kapital bei Stiftungen und deren steuerrechtliche Behandlung am Beispiel der Einlagerückgewähr«
Abstract:
Privatnützige Stiftungen erfreuen sich steter Beliebtheit, insbesondere als Gestaltungsinstrument der Nachfolgeplanung. Dabei spielen steuerrechtliche Aspekte eine wesentliche Rolle. Jedoch kennt das Steuerrecht kein eigenes „Stiftungssteuerrecht“, sondern wendet mit wenigen Ausnahmen allgemeine Steuervorschriften an. Dabei überrascht es nicht, dass die allgemeinen Besteuerungsregelungen nicht immer dem Wesen und der Besonderheiten von Stiftungen gerecht werden. Dies wirft insbesondere bei der Besteuerung von Destinatsleistungen die Frage auf, wie diese zu behandeln sind und unter welchen Voraussetzungen sie unter welche Besteuerungstatbestände fallen. Dies ist ein Teilaspekt der grundlegenden Frage, ob und wie die Ausschüttung von Vermögen einer privatnützigen Stiftung besteuert wird, namentlich am Beispiel einer Einlagerückgewähr im Sinne des § 27 KStG. Die Frage nach der steuerfreien Einlagerückgewähr durch Stiftungen an ihre Destinatäre ist Gegenstand einiger Diskussionen in der Literatur. Mit Urteilen vom 17. Mai 2023 hat der Bundesfinanzhof (BFH, Az. I R 42/19 und Az. I R 46/21) dieser mittels eines steuerlichen Einlagekontos nach § 27 KStG eine Absage erteilt, ohne sich jedoch damit auseinanderzusetzen, ob es dem Grunde nach auch bei Stiftungen zu einer sinngemäßen Einlagerückgewähr kommen kann. Die Urteile werfen damit mehr Fragen auf, als sie beantworten. Ziel der Arbeit ist es daher, eine systematische Einordnung der aufgeworfenen Fragestellungen zu erarbeiten und Lösungsansätze unter Berücksichtigung der Dogmatik, den Grundprinzipien des Stiftungs- und Steuerrechts und einer gerechten Besteuerung zu entwickeln.
Marquardt Petersen
Leuphana Universität Lüneburg; Doktorvater: Prof. Dr. Rainer Lueg
Dissertation:
»Bewertung des Verhältnisses von Unternehmensgröße und Nachhaltigkeits-Berichterstattung - Eine Meta-Analyse und Fallstudien«
Abstract:
This cumulative dissertation investigates the relationship between firm size and CSR (Corporate Social Responsibility) reporting within the management literature. Through a systematic literature review (SLR) and case studies, the primary aim is to build a robust theoretical foundation for understanding the influence of firm size on sustainability practices. The first component of this dissertation, a book chapter published with IDW Verlag, explores carbon accounting practices, providing a foundational understanding of sustainability reporting. Building on this, the current focus is conducting a systematic literature review (SLR). This unique SLR critically examines existing research to identify key themes, theoretical frameworks, and gaps in understanding the impact of firm size on CSR reporting. The SLR offers a comprehensive and nuanced examination of the literature, ensuring thoroughness and allowing for the identification of diverse conceptualisations and measures of firm size. The forthcoming case studies will investigate the empirical relationship between firm size and sustainability practices. By examining both large corporations and small to medium-sized enterprises (SMEs), these case studies aim to uncover how different dimensions of firm size, such as market share, employee count, and revenue, affect the quality and scope of CSR reporting. Additionally, the research will investigate whether there is a threshold size at which CSR practices significantly evolve and how contextual factors like industry and regional regulations influence this relationship. Overall, this dissertation seeks to enhance the theoretical discourse by providing a detailed conceptual framework that clarifies the role of firm size in CSR reporting. The theoretical contributions and the practical insights from the case studies will inform policymakers and business leaders, enabling them to develop more tailored and practical sustainability strategies for organisations of varying sizes. This research aims to encourage more effective and impactful CSR practices across the corporate landscape by addressing the complexities and unique challenges different-sized firms face.
Leoni Mendler
WHU Otto Beisheim School of Management Vallendar; Doktorvater: Prof. Dr. Michael Frenkel
Dissertation:
»Chinese Development Finance in Africa: An Empirical Analysis of the Mutlidimensional Effects«
Abstract:
China has emerged as a leading international creditor and is now competing with traditional Western donors and lenders. Between 2000 and 2017, China committed more than USD 840 billion in official finance to developing countries. The flagship Belt and Road Initiative, launched in 2013, provides for unprecedented infrastructure investment in about 150 countries. Western criticism of a lack of transparency prompted speculation about the economic effectiveness and environmental impact of Chinese lending abroad. We examine whether Chinese official finance to Africa between 2000 and 2017 contributed to economic growth and led to a “greener” electricity generation, the backbone for a sustainable energy transition on the continent. To avoid endogeneity concerns, we employ an instrumental variable approach that relies on the exogenous variation in the availability of Chinese official finance over time. Our findings suggest that Chinese lending in the period 2000-2017, in particular concessional finance, had a positive impact on economic growth and the use of renewable energy in the electricity sector.
Levent Yer
HHL Leipzig Graduate School of Management; Doktorvater: Prof. Dr. Bernhard Schwetzler
Dissertation:
»Unpacking performance drivers in private equity investments: Deciphering the determinants of 'skin in the game' and loss ratios, as well as their impact on fund performance«
Abstract:
The evolution of the private equity (PE) industry, particularly its buyout business model, has significantly influenced wealth management and institutional investment strategies over recent decades. This doctoral research explores the integration of environmental, social, and governance (ESG) criteria within PE investments, driven by the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) introduced by the European Commission in 2022. Despite PE’s potential for high returns, complexities in ESG measurement and reporting pose challenges, exacerbated by ambiguous regulatory frameworks. This study aims to analyze the impact of SFDR on ESG reporting by PE funds, examining how PE firms define and score ESG criteria, the changes in behavior and reporting standards post-SFDR, and the efficacy of regulatory measures in minimizing greenwashing. Through a structured approach involving extensive literature reviews and analysis of current policies, this research seeks to enhance understanding of PE's ESG practices, contributing to the broader societal discourse on sustainable investment and the diversification of public funds into private markets. The findings will inform legislators and public institutions, aiming to democratize asset classes and ensure the effective allocation of taxpayer money towards socially responsible investments
Emilie Antonia Höslinger
Ludwig-Maximilians-Universität München; Doktorvater: Prof. Dr. Niklas Potrafke
Dissertation:
»Fiskalregeln als ordnungspoltisches Instrument zur Begrenzung der Staatsverschuldung«
Abstract:
Die Dissertation befasst sich mit der viel diskutierten Wirkung von Fiskalregeln auf öffentliche Finanzen und makroökonomische Variablen in verschiedenen wirtschaftlichen und institutionellen Kontexten. Die erste Studie analysiert Spillover-Effekte nationaler Fiskalregeln innerhalb einer Währungsunion. Anhand historischer Beispiele wie Österreichs Einbindung in das Europäische Währungssystem wird mit der synthetischen Kontrollmethode untersucht, ob Fiskalregeln in einem Land die Zinskosten anderer Staaten beeinflussen. Die zweite Studie betrachtet die Einführung einer strikten sub-nationalen Fiskalregel in Tennessee (1977) und deren langfristige Effekte auf Verschuldung, Wachstum und öffentliche Ausgaben. Ein kontrafaktisches Szenario zeigt die wirtschaftlichen Folgen restriktiver Fiskalpolitik. Die dritte Studie analysiert Reformen des italienischen Stabilitätspakts seit 1999 und überprüft, ob frühere Forschungsergebnisse robust gegenüber Reformänderungen sind. Mithilfe eines Difference-in-Discontinuity-Designs werden Effekte auf Haushaltsdefizite, Steuersätze, Investitionen und Korruption untersucht.
Leonard Baum
Public Policy, Hertie School, Centre for Digital Governance; Doktormutter: Prof. Dr. Joanna Bryson
Dissertation:
»Mapping the Digital Economies of the G20. A quantitative examination of the competitive dynamics of digital markets and the impact of different regulatory regimes.«
Abstract:
Growing global concern about the problems associated with concentrated market power in the digital economy is leading to a renewed interest in competition policy. This research proposal introduces a novel approach to map and compare the digital economies of the G20. A market capitalisation approach, building on the informativeness of financial markets, is used to quantitatively examine competitive dynamics in digital markets and the impact of different regulatory regimes. Recognising the lack of a common definition of the digital economy, data issues and different measurement methodologies, the study uses the OECD framework to define the digital economy and the Global Industry Classification Standard (GICS) to delineate relevant markets. Market capitalisation data is used as a key tool to calculate concentration measures such as the Herfindahl-Hirschman Index (HHI) and the four-firm concentration ratio (CR4). By comparing different indicators of competitiveness across G20 countries, the research aims to provide critical insights into the interplay between market power and competitiveness, while also examining the effectiveness of different regulatory regimes. This comparative perspective provides a basis for mutual learning among policymakers, competition authorities and academics, contributing to a deeper understanding of digital markets and competition policy in different contexts.
Korbinian Wester
Wirtschaftswissenschaften, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; Doktorvater: Prof. Dr. Dr. h.c. Lars P. Feld
Dissertation:
»Fiscal Policy for Public Investment«
Abstract:
Das Promotionsprojekt mit dem Titel „Fiscal Policy for Public Investment“ widmet sich den Herausforderungen, denen sich Kommunen in Deutschland im Kontext fiskalpolitischer Restriktionen und Investitionsentscheidungen gegenübersehen. Die Dissertation untersucht, wie Kommunen auf strenge Haushaltsvorgaben reagieren und inwieweit gezielte Fördermaßnahmen Investitionen beeinflussen können. Zwei zentrale Fragestellungen stehen im Fokus: Erstens, ob und wie Kommunen bei verschärften Haushaltsvorgaben Schulden in kommunale Unternehmen auslagern. Zweitens, ob zweckgebundene Fördermittel in Form von Investitionszuschüssen tatsächlich zu erhöhten Investitionen auf kommunaler Ebene führen. Zur Beantwortung dieser Fragen wird ein empirischer Ansatz verfolgt, der sowohl die Erstellung einer umfassenden Datenbank zu kommunalen Unternehmen in Deutschland als auch die Anwendung verschiedener ökonometrischer Methoden zur Analyse von Förderprogrammen umfasst. Ziel ist es, praxisrelevante Handlungsempfehlungen für eine effizientere öffentliche Investitionspolitik zu erarbeiten und die wissenschaftliche Literatur im Bereich der kommunalen Finanzpolitik zu erweitern.
Magdalena Bohrer
Politische Philosophie, Ludwig-Maximilians-Universität München; Doktorvater: Prof. Dr. Martin Rechenauer
Dissertation:
»Solidarität als politischer Wert und ihre Institutionalisierung«
Abstract:
Solidarität“ ist nicht nur ein häufig verwendeter Begriff, sondern auch ein politischer Wert, der europaweit über Parteigrenzen hinweg als zentral betrachtet wird. Zudem ist die Annahme gängig, dass der Wohlfahrtsstaat eine Institutionalisierung von Solidarität darstellt. Meine Dissertation beschäftigt sich hauptsächlich mit der Frage, was der scheinbar so zentrale politische Wert der Solidarität und dessen behauptete Institutionalisierung aus einer wissenschaftlichen Perspektive betrachtet eigentlich meint. Um diese Frage beantworten zu können, beschäftige ich mich mit mehreren Unterfragen. So kläre ich unter anderem begriffsgeschichtlich, was unter dem Begriff „Solidarität“ allgemein verstanden werden kann und ob die vielen verschiedenen Verständnisse des Begriffs einen gemeinsamen Kern haben. Ich frage, was es bedeutet, ein politischer Wert zu sein, und inwiefern sich Solidarität als politischer Wert von detaillierter untersuchten politischen Werten wie Gerechtigkeit und Freiheit unterscheidet. Zudem behandle ich die Fragen, ob man Personen grundsätzlich zu Solidarität verpflichten kann und damit verbunden, ob sich Solidarität als politischer Wert überhaupt institutionalisieren lässt und ob dies allgemein wünschenswert ist.