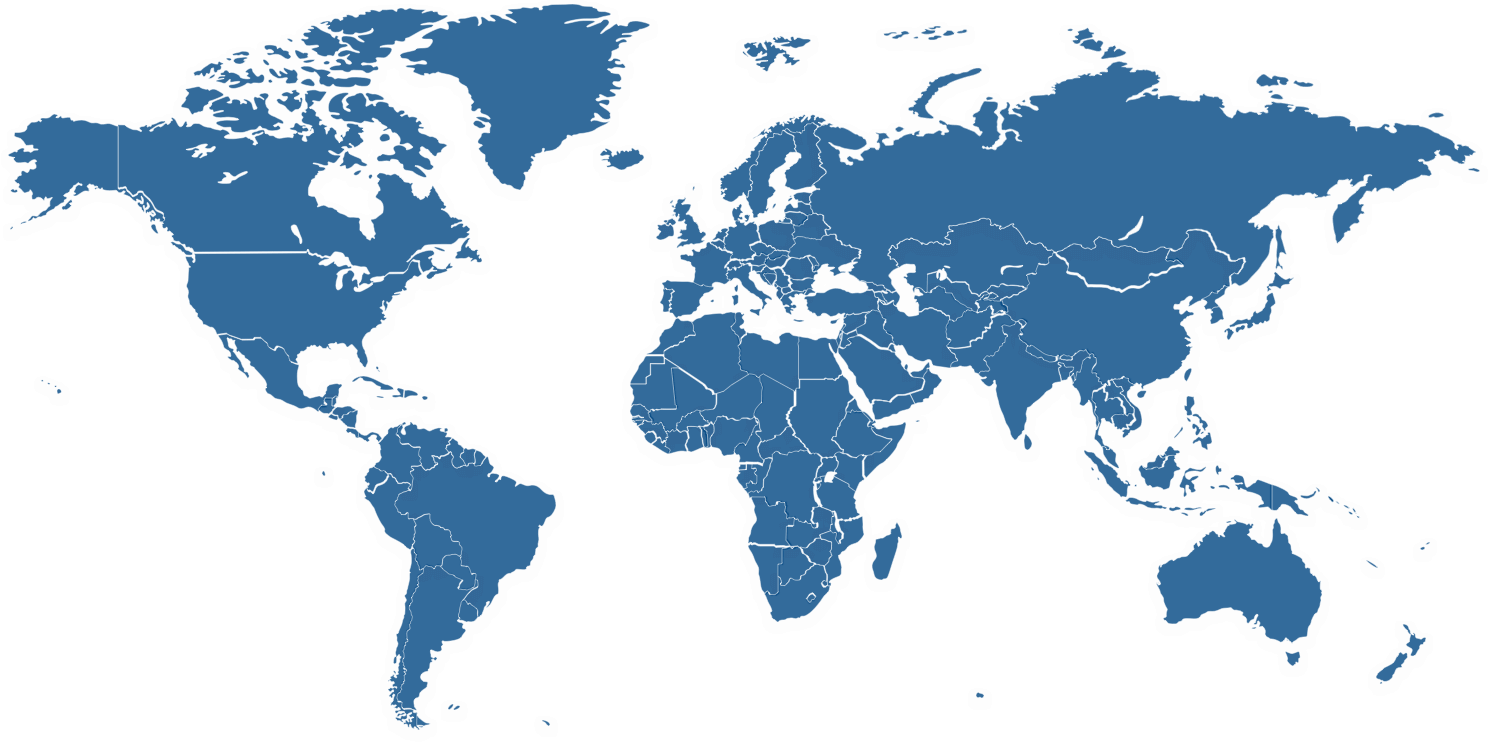"Der Zustand der Umwelt in Bolivien"
Jüngste Untersuchungen zeigen, dass die Umwelt weltweit Probleme damit hat, ihr Gleichgewicht zu halten, da sie dramatische Schäden erlitten hat. Diese wurden unter anderem durch den unvernünftigen Rohstoffabbau, die Industrialisierung, die Umweltverschmutzung und die unangemessene Bevölkerungsexplosion verursacht. Insofern stehen die Gesellschaft und die Wirtschaft weltweit aktuell ernormen Herausforderungen auf Ebene des Ökosystems gegenüber und es besteht die dringliche Notwendigkeit auf den Klimawandel und die Rohstoffknappheit, ebenso wie auf den steigenden Energiebedarf, zu reagieren.
In Deutschland stellt die Energiepolitik der nächsten Jahren auf einen parteinenübergreifenden Konsens ab, welcher auf einem starken Energieumstiegsprozess basiert. Deutschland versucht bis 2050, vollständig auf erneuerbare Engergiequellen umzusteigen, die Treibhausgase drastisch zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Der Konsens schlieβt den Entschluss mit ein, komplett aus der Beteiligung an der Nuklearenergie auszusteigen. Dies soll auf fortschreitende Weise bis 2022 geschehen. Mit dem Ziel diese Aufgaben mit Erfolg zu vollenden, benötigt Deutschland umbedingt die Unterstützung seiner internationalen Partner, insbesonder derer aus Lateinamerika. Diese Hilfe stützt sich auf einen intensiven Ideenaustausch und eine Verbesserung des Lernens auf allen Ebenen.
Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) erfüllt seine vor Jahren eingegangene internationale Verpflichtung in Bolivien und arbeitet in der Umweltthematik. Die vorliegende Aushändigung über „den Zustand der Umwelt in Bolivien“ war ein Projekt, welches von der Stiftung Millenium unter der Leitung von Napoleón Pacheco ausgearbeitet und koordiniert wurde. Napoleón Pacheco hat das Ziel, einen „Stand der Dinge“ über der Situation in Bolivien zu verfassen und die bolivianische Bevölkerung für ein propositives und proaktives Bewusstsein über die Umweltproblematik zu sensibilisieren.
Bolivien besitzt gesetzliche Regelungen und eine Institutionalisierung des Umweltmanagaments, welche seit zwei Jahrzehnten kontinuierlich entwickelt wurden. Wie in vielen Fällen war das Land Vorreiter bei der Errichtung staatlicher Strukturen, um den Herausforderungen entgegenzutreten, welche anfingen sich in der Weltordnung durchzusetzen und welche es seit dem Appell der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung, oder der Ríokonferenz 92, engültig zu kassifizieren gilt. Im Dezember 1992 berief die Umweltkommission der Abgeordnetenkammer ein Forum zur Untersuchung der Umweltproblematik des Landes ein. Als Ergebnis dieses Forum leitete man einen Vorentwurf des Umweltgesetzes ein, was 1992 in der Verabschiedung des Gesetzes 1333 mündete. Diese Richlinie wurde in einem Verfahren mit einer breiten Partizipation der verschiedenen Gruppierungen und sozialen Organisationen ausgearbeitet. Der Entwurf und die Erlassung dieser Norm war ein Hauptmeilenstein des Umweltmanagements, da sie ein Vorher und ein Nachher in der Institutionalisierung der Umwelt in Bolivien markiert. Wie Mónica Castro erwähnt,stimme des Gesetz mit den kritischen Betrachtungsweisen des wirtschaftlichen Aufschwungs überein , welche eine Wende hin zum neuen Paradigma „der nachhaltige Entwicklung“ fordere und im Land ein geeignetes Umfeld zur Applikation vorfände.
Unlängst, 2009, durch die neue Verfassung, wurden umfassendere Kriterien in das Sachgebiet der Umwelt und Rohstoffe aufgenommen. Einerseits werden als Ziele und wesentliche Funktionen des Staates „die Förderung und die Gewährleistung einer veranwortungsvollen und geplante Nutzung der Rohstoffen und das Vorantreiben ihrer Industrialisierung, mithilfe der Entwicklung und der Stärkung der Produktionsbasis in ihren verschiedenen Dimensionen und Nivelen; sowie die Erhaltung der Umwelt für das Wohlergehen der jetzigen und zukünftigen Generationen“ festgelegt. Andererseits wird in Verbindung mit den indigenen Völkern etablieert, dass „im Rahmen der Einheit des Staates und im Einklang mit der Verfassung die Nationen und einheimischen indigenen Bauernvölkern das Recht genieβen, in einer intakten Umwelt zu leben und das Ökosystem angemessenen zu nutzen“.
Trotz der Fortschritte, welche in Bolivien in der Umweltthematik realisiert wurden, existieren Lücken in anderen Bereichen. Zum Beispiel besitzt das Land keine spezifische Richtlinie zum Klimawandel, dennoch besitzt es ebenso wie andere Nationen eine Umweltnorm und hat internationale Abkommen zum Klimawandel unterzeichnet. Das Land hat das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über den Klimawandel unterschrieben und dieses durch das Gesetz 1576 in seine Rechtstruktur aufgenommen. In diesem wird sich darauf bezogen, dass die sektorale Umweltproblematik daraus resultiert, dass sich Bolivien unter den 12 Ländern mit der gröβten Abholzung befindet. Das Land verlor zwischen 2000 und 2012 29.867 km² seiner Wälder. Mehr als 46 Prozent des bolivianischen Hoheitsgebietes sind mit Wald bedeckt, was die Anwendung von verschieden Umgangs- und Schutzstrategien erfordert.
Im Treibstoffsektor ist eine der Herausforderungen des Umweltmanagements die Projektentwicklung in Bereich der Erhaltung der Artenvielfalt und wichtiger Wasserquellen. Das ist der Fall im Gebiet Liquimuni, in den Schutzzonen von Madidi, Pilón Lajas und bei der Treibstoffaktivität im Nationalpark Aguaragüe. Projekte, welche zwar über Maβnahmen zur Abmilderung verfügen, sind in Gebieten mit einem empfindlichen Ökosystemo oder wichtigen Süβwasserquellen nicht ausreichend. Dieser Entschluss ergibt sich aus einer Übereinstimmung, welche unter den Politiken des Staates bestehen sollte. Auf der einen Seite wird die Muttererde geschützt und auf der anderen führt diese Art von Projekten dazu, dass sie verletzt wird.
Hinsichtlich des Minensektos bezieht sich dieselbe Rechnung auf das historisches Erbe im Bereich der Umweltverschmutzung, welches noch nicht gelöst wurde. Es bleiden sichtbare Auswirkugen in verschiedenen Minenortschaften zurück, welche die tägliche Lebensqualität der Bewohner beeinflussen. Niemand muss für sein Verhalten die Verantwortung übernehmen. Ein neues Minengesetz wurde soeben verabschiedet. Dieses weist eine Reihe von Widersprüchen mit dem Gesetz der Mutter-Erde auf. Im Wesentlichen beziehen sich diese auf die Mineralgewinnung in den Schutzgebieten und auf den Gletschern, auβerdem auch auf die Nutzung von Rohstoffe seitens der bergmännischen Lizenznehmer, beispielsweise Gewässer, welche beliebig und kostenlos genutzt werden. Ein grundlegender Punkt zur Regulierung der am meisten verschmutzendenTätigkeiten der Kooperativen und der kleinen Bergarbeiterschaft ist die Notwendigkeit der Errichtung eines Förderprogrammes, welches den Kooperativen den Zugang zu Technologien zu einem geringeren Preis erlaubt, damit sie sich an den Rahmen der Umweltgesetzgebung halten. Die Herausforderung für den Sektor ist es, alle Minenakteure in das Umweltmanagement miteinzubeziehen.
Der Energiesektor steht möglicherweise vor umfangreichen Struktur- und Umweltherausforderungen. In den nächsten Jahren wird er sich durch Groβprojekte - darunter der Staudamm Bala, die Cachuela Esperanza, die Geothermik in der Salzwüste von Uyuni, die Kernenergie im Norden von Potosí - stärker entwickeln. Für diesen Sektor ist es von lebensnotwendiger Bedeutung, spezifische gesetzliche Regelungen zu entwerfen.
Ruben Ferrufino hebt hervor dass, die Problematik des Klimawandels uns überrumpelt habe, da sie nicht über die notwendige Instutusionalisierung verfüge, um ihr entgegenzutreten. Vereinzelte Aktionen in bestimmten Bereichen nützten nichts, wenn wir nicht eine globale Handlung und Politiken verfügten, welche alle Sektoren des Landes miteinbeziehen. Es sei wichtig, im Kopf zu behalten, dass das Problem des Klimawandels alle Einzelaktionen der Regierung überschreite und Herausforderungen bedeute, an welchen die gesamte Gesellschaft beteiligt ist. Die Klimawandelpolitik sollte transversal sein und sollte zugleich Bestimmungen für die verschiedenen Sektoren beinhalten. Auβerdem sollte sie eine Kostenbeteiligung als kurzfristige Lösung und nachhaltigen Profit bieten. In dem Maβe wie die vorherrschende Sichtweise bei vielen Aktivitäten eine kurzfristig sei, sei es logisch, dass dem Übernehmen eigener aktueller Kosten für den allgemeinen Vorteil auf mittelfristige und lange Sicht hin wenig Interesse geschenkt werde.
Der Staat fordert die verstärkte Institutionalisierung zur Verwaltung und Beobachtung der Klimawandelpolitik. Der private Sektor bedarf der Leistung der Institutionen, um kosteneffiziente Maβnahmen einzugliedern, damit er den Rythmus der Evulationen, mit dem Ziel von besseren Praktiken und Produktionsprozessen, richtig dosieren kann und so die Veränderungen nicht die Durchführbarkeit Produktionseinheiten gefährden. Letztendlich bedarf auch die Gesellschaft der Institutionalisierung, um den Klimawandel und die Bedeutung der Umwelt in ihre Werte aufzunehmen. Diese Werte sind jene, welche später Teil der täglichen Anwendung des Produktionsmodells werden.
Abschlieβend soll allen Analytikern und Wissenschaftlern der Stiftung Millenium gedankt werden: Mónica Castro, Rubén Ferrufino, Hernán Zeballos und Evelyn Taucer für die bedeutende Unterstützung der Recherche und der Studie zur Umweltsituation in Bolivien; dem Geschäftsführer der Stiftung Millenium, Napoléon Pacheco, für die Koordination und die Idee für die Studie.