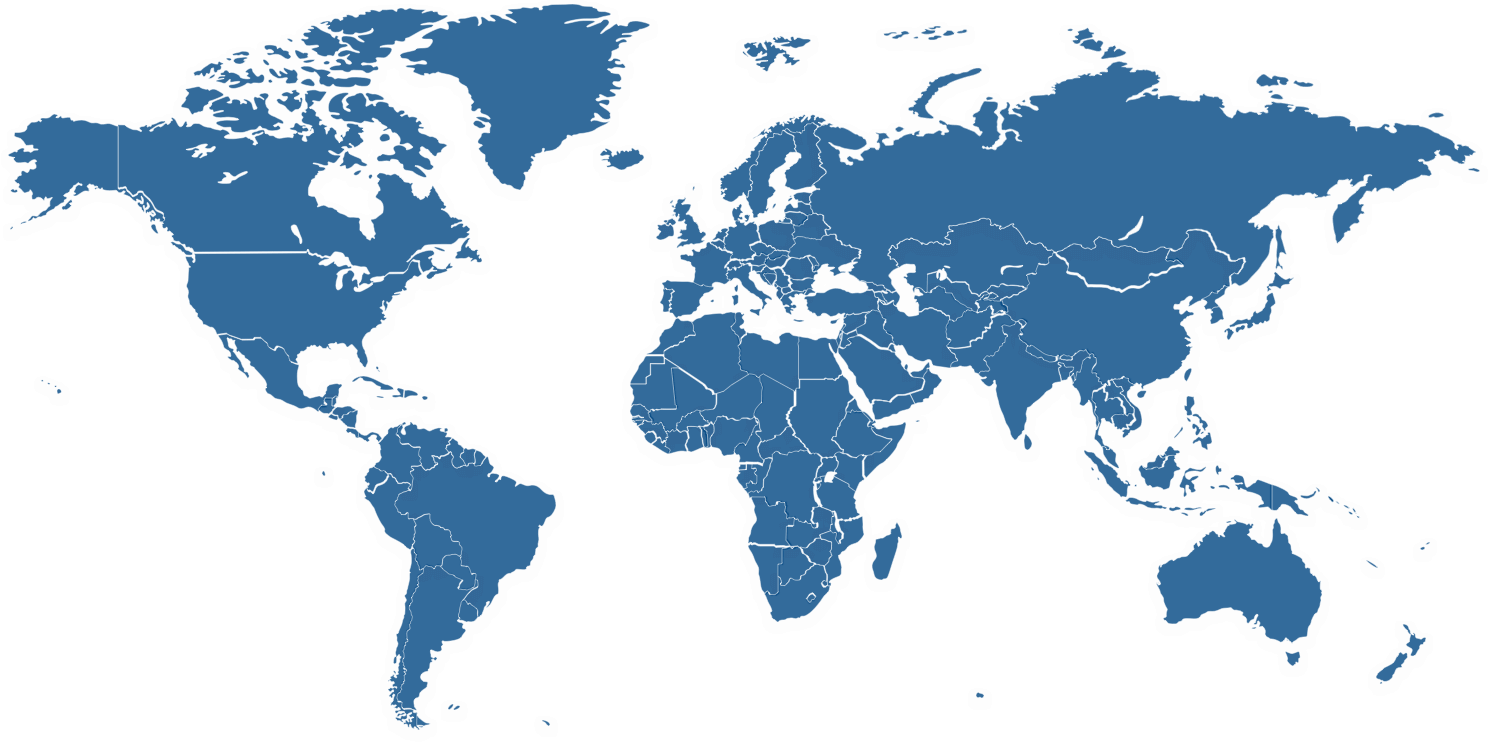Kickl verhindert – noch
Anfang 2025, nachdem die Verhandlungen zur so genannten Zuckerl-Koalition gescheitert waren und die ÖVP in Verhandlungen mit der FPÖ eintrat, hätte kaum jemand im politischen Wien Geld darauf gewettet, dass auch diese Verhandlungen scheitern würden. Dass es doch so kam, lässt sich auf unüberbrückbare Differenzen in einigen Grundsatzfragen (Europa, Demokratie und Rechtsstaat), unversöhnlich geführten Auseinandersetzungen um Postenverteilungen, ganz zuvorderst aber auf die Tatsache zurückführen, dass der FPÖ-Kanzler in spe, Herbert Kickl, nicht bereit war, sich zugunsten einer Regierungsbeteiligung zähmen und einhegen zu lassen.
Unter der Führung von Kickl hat sich die FPÖ in den letzten Jahren weiter radikalisiert. Sie vertrat und vertritt extreme Positionen in der Sicherheits-, Migrations- und Covid-Politik. ÖVP-Regierungsmitglieder wurden von Kickl als „Volksverräter“ bezeichnet, die er auf „Fahndungslisten“ setzen werde, sollte er „Volkskanzler“ sein. Dieser Extremkurs fand zwar Beifall bei der eigenen Anhängerschaft, führten aber auch zu erheblichen Spannungen mit dem potenziellen Koalitionspartner. Die ÖVP bezeichnete Kickl entsprechend als „rechtsextrem“ und „Sicherheitsrisiko“.
Trotzdem führte man ab Januar 2025 Koalitionsgespräche miteinander. Innerhalb der ÖVP war in diesem Zusammenhang und angesichts eines drohenden EU-Budgetdefizitverfahrens und der Alternative Neuwahlen immer wieder von „Staatsräson“ die Rede. Man befürchte, die FPÖ werde bei einem Scheitern der Regierungsverhandlungen in Neuwahlen noch stärker abschneiden.
Unter ihrem neuen Interimsvorsitzenden Stocker formulierte die ÖVP noch vor Beginn der Verhandlungen mit der FPÖ drei rote Linien für eine zukünftige Regierungsarbeit: Österreich müsse (1) ein verlässlicher Partner innerhalb der EU bleiben, (2) auch weiterhin auf der Seite der Demokratien der Welt stehen und sich gegen ausländische (vor allem russische) Einflussnahme zur Wehr setzen sowie (3) für die Bewahrung von Demokratie und Rechtsstaat sorgen. Bis zuletzt gab es von der FPÖ kein grundsätzliches Bekenntnis, diese roten Linien zu akzeptieren. Zusätzlich stritten sich beide Parteien öffentlich um Postenbesetzungen und die Verantwortung für die besonders sensiblen Bereiche Justiz, Inneres und Nachrichtendienste, bis schließlich FPÖ-Chef Kickl den Regierungsbildungsauftrag an den Bundespräsidenten erfolglos zurückgab.
Naheliegend ist, dass Kickl ein Scheitern der Verhandlungen nicht nur in Kauf zu nehmen bereit war, sondern eine erfolgreiche Regierungsbildung möglicherweise gar nicht sein Ziel war. Für einen Populisten, der vor allem von der diffusen Unzufriedenheit „mit denen da oben“ lebt, ist es in der aktuellen Krisensituation schließlich deutlich leichter, vom Seitenrand aus Brachialkritik zu üben als Kompromisse einzugehen, um Führung und Verantwortung für das Land zu übernehmen.
Kickl selbst investierte auffällig wenig Zeit in die Verhandlungen, zeigte sich aber in der öffentlichen Kommunikation ähnlich populistisch und kompromisslos wie im Wahlkampf. Ob ihm dieses Verhalten langfristig schaden wird oder er auch diesmal mit seiner „Schuld-sind-immer-die-anderen“-Erzählung durchdringt, bleibt abzuwarten. Es gibt jedenfalls sowohl in der Partei als auch in deren Anhängerschaft einige regierungswillige Kräfte, die das Scheitern der Koalition mit der ÖVP für eine verpasste Chance halten.
Kurzfristig scheint der FPÖ das Scheitern der Koalitionsverhandlungen jedenfalls nicht geschadet zu haben. Im Gegenteil: Aus den 2,5 Prozent Vorsprung, die die FPÖ bei der Nationalratswahl vor der ÖVP hatte, sind in den letzten Wochen in einigen Umfragen schon 15 Prozent geworden.
Die Koalition der letzten Chance
Dass die Zuckerl-Koalition im zweiten Anlauf schließlich zustande kam, ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sie nach dem Scheitern von Blau-Schwarz fast schon alternativlos geworden war. Unter diesen Bedingungen ließ sich dann auch der SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler zu ein paar Kompromissen hinreißen, nachdem er in den Augen der meisten Beobachter noch hauptverantwortlich für das Scheitern der ersten Verhandlungen gewesen war.
In der neuen Regierung erhält die SPÖ das Sozial- und Gesundheitsministerium sowie unter anderem die Ressorts Finanzen, Justiz und Infrastruktur. Von ihrer Forderung nach einer Vermögenssteuer musste sie in den Verhandlungen abrücken, bekommt aber zumindest die Bankenabgabe. Die NEOS konnten ihre Herzensthemen zumindest personell besetzen: Bildung, Äußeres und Entbürokratisierung. Die Kanzlerpartei ÖVP erhielt neben dem Bundeskanzleramt unter anderem Inneres (mit Migration), Verteidigung, Wirtschaft und Energie sowie die EU-Agenden.
Die FPÖ hat sich nach einer kurzen Unterbrechung während der eigenen Koalitionsverhandlungen wieder auf das Narrativ von der „Verliererkoalition“ eingestimmt. Tatsächlich steht die neue Regierung nach fünf Monaten Koalitionsverhandlungen, die erst im dritten Anlauf zum Abschluss führten, von Anfang an unter erheblichem Druck. Bundeskanzler Stocker stand selbst nicht als Spitzenkandidat zur Wahl. Er ist erfahren, kennt das Geschäft und hat den ÖVP-Dampfer aus einer außerordentlich turbulenten Phase wieder in ruhigere Gewässer geführt.
Eine ruhige, führende Hand wird auch in den kommenden Jahren nötig sein, denn zu dritt – das hat zuletzt die deutsche Ampel-Koalition gezeigt – regiert es sich erheblich schwieriger als zu zweit. Die Koalitionspartner geben sich betont zuversichtlich, wissen aber, dass sie vor allem in den Bereichen Wirtschaft und Migration für die Bevölkerung spürbare Verbesserungen herbeiführen müssen. Insbesondere die ÖVP, die beide Themen als ihre Kernkompetenzen betrachtet, ist hier maßgeblich in der Pflicht. Erschwert wird das Ganze allerdings dadurch, dass der Handlungsspielraum nationaler Regierungen in beiden Politikbereichen relativ begrenzt ist und sowohl der eigene Wohlstand als auch die innere Sicherheit im Kontext von Migration und Integration sehr stark von subjektiven Wahrnehmungen abhängen.
Im Hinblick auf die Größe der Herausforderungen und die jüngsten Umfragewerte der FPÖ wird in Österreich dieser Tage häufiger von der „Koalition der letzten Chance“ gesprochen. Tatsächlich dürfte es ganz maßgeblich vom Agieren der jetzt ins Amt gekommenen Bundesregierung abhängen, ob es gelingt, die wesentlichen Herausforderungen zu bewältigen, dadurch für stabile Verhältnisse in der politischen Mitte zu sorgen und so letztlich zu verhindern, dass an Herbert Kickl und der FPÖ bei der nächsten Wahl gar kein Weg mehr vorbeiführt.
Ob das gelingt, hängt maßgeblich auch von der Führung durch Bundeskanzler Christian Stocker ab, der erst im Januar 2025 zum geschäftsführenden Parteivorsitzenden der ÖVP designiert wurde und davor auch nur zwei Jahre Generalsekretär der Partei war. Zuvor mehrere Jahrzehnte in der Kommunalpolitik in Wiener Neustadt aktiv, ist der 65-Jährige in der Bundespolitik trotz seines Alters ein Newcomer. Gleichwohl hat er schon jetzt bewiesen, dass er, wenn es drauf ankommt, in der Lage ist, bei Grundsatzfragen prinzipienfest, in Sachfragen trotzdem pragmatisch und kompromissbereit zu sein. Seine Durchsetzungsfähigkeit, seine Beharrlichkeit sowie sein unaufgeregtes Auftreten werden entscheidend sein, um die Koalition zusammenzuhalten und gleichzeitig die eigene Führungsrolle zu behaupten.
Der vielzitierte Satz von Jens Spahn „Entweder die politische Mitte beendet die illegale Migration, oder die illegale Migration beendet die politische Mitte“ scheint auf Österreich in besonderem Maße zuzutreffen. Unter dem Druck der ÖVP und Stocker ist es gelungen, sich im Regierungsprogramm auf sehr restriktive Maßnahmen im Asyl- und Migrationsbereich zu einigen. Diese umfassen unter anderem
- einen vorübergehenden Stopp des Familiennachzugs im Einklang mit Art. 8 EMRK;
- die Umsetzung und Weiterentwicklung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) mit dem Ziel, die Asylanträge auf null zu reduzieren;
- bei einem Anstieg der Asylanträge die Anwendung der EU-Notfallklausel (Art. 72 AEUV) unter der Berücksichtigung der EUGH-Judikatur;
- den Zugang zu vollen Sozialleistungen erst nach bis zu drei Jahren während der Integrationsphase im verfassungs- und europarechtlichen Rahmen.
Und Karl Nehammer? Der Ex-Bundeskanzler ist in gewisser Hinsicht die tragische Figur des Rekordregierungsbildungsprozesses. Obwohl es am Ende tatsächlich die von ihm von Anfang an favorisierte und über Monate hartnäckig verfolgte Zuckerl-Koalition geworden ist, wird er selbst in der Regierung keine aktive Rolle mehr spielen, geschweige denn, diese Regierung als Bundeskanzler anführen. Nehammer hat sich (zumindest vorerst) aus der Politik zurückgezogen.
Die Krise als außenpolitische Chance
Mit seiner nach wie vor verfassungsmäßig festgeschriebenen Neutralität ist Österreich ein Ausnahmefall in der Europäischen Union – ein Ausnahmefall, der nach dem Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO, sogar noch ein wenig exotischer geworden ist. Zu den USA im Allgemeinen und der NATO im Besonderen pflegt man in Österreich ganz unabhängig von Trump traditionell ein eher ambivalentes Verhältnis – bedingt auch durch eine historisch geprägt größere Nähe zu Russland. Obwohl auch Österreich vom Schutz der Vereinigten Staaten profitiert (hat), tat man sich bei aktiver Mitwirkung im NATO-Rahmen immer schwer.
Die jüngste Krise im transatlantischen Verhältnis könnte vor diesem Hintergrund für die österreichische Außenpolitik auch eine Chance im Sinne eines Gelegenheitsfensters für ein noch aktiveres Engagement in der und für die europäische Sicherheitsarchitektur sein. Insbesondere durch die Regierungsbeteiligung der liberalen NEOS, die nun das Außenministerium führen und wie keine andere österreichische Partei für eine aktivere sicherheitspolitische Rolle Österreichs eintreten, sind hier durchaus bemerkenswerte Akzentverschiebungen möglich.
Österreich hat angekündigt, sich an der Verteidigungs- und Rüstungsinitiative ReArm Europe zu beteiligen und in den letzten Jahren bereits begonnen, deutlich mehr in die eigene Verteidigung zu investieren. Lag das durchschnittliche Militärbudget in den vergangenen Jahrzehnten bei nur etwa 0,7% des BIP, ist es im Zuge des so genannten Aufbauplan 2032+ auf mittlerweile 1,1% angewachsen. 2032 soll es bei 2,0% liegen.
Auch für das deutsch-österreichische Verhältnis wäre der fast zeitgleiche Start zweier christdemokratisch geführter Regierungen eine außenpolitische Chance, wieder Schwung in die traditionell guten, aber nicht immer prioritär behandelten bilateralen Beziehungen zu bringen. Nicht nur in Wien, sondern auch in Berlin ist dieser Tage schließlich immer häufiger von der vermeintlich letzten Chance die Rede.