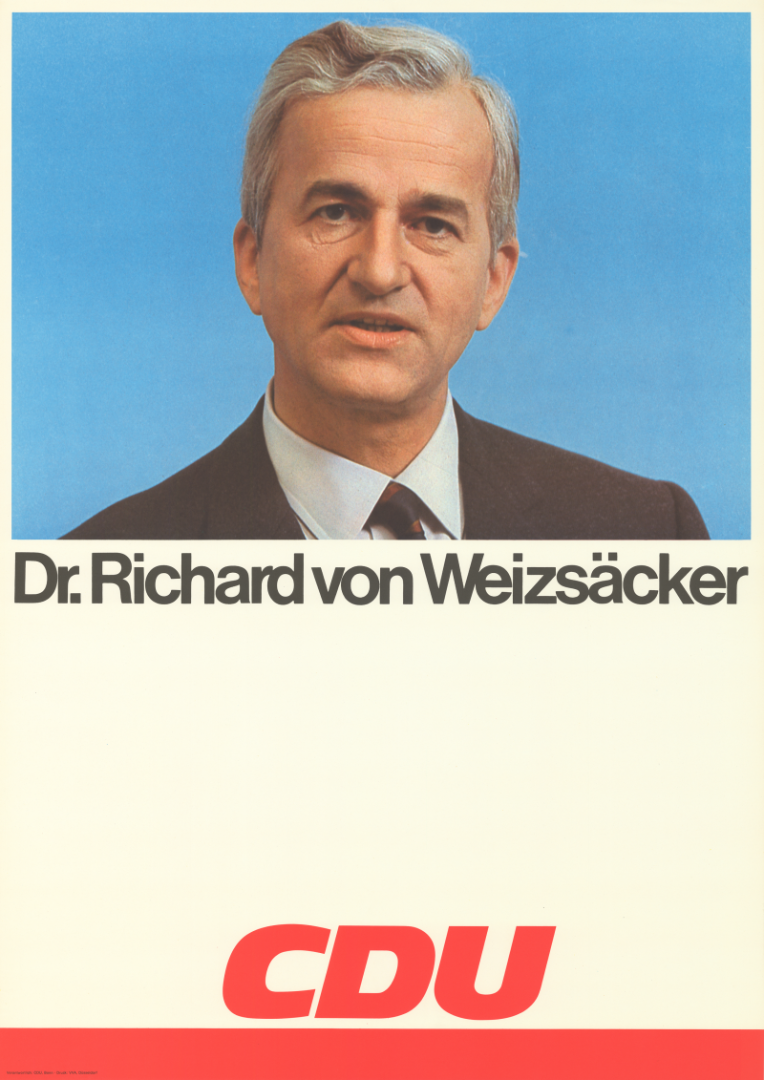Übersicht – Springen Sie in die jeweiligen Abschnitte:
☛ Der „ideale Liberalkonservative“
☛ Herkunft, Ausbildung und Beruf
☛ Protestantische Prägung und politisches Engagement
☛ Abgeordneter des Deutschen Bundestags
☛ Schärfung des liberalkonservativen Profils der CDU
☛ Regierender Bürgermeister von Berlin
Der „ideale Liberalkonservative“
„Man muss sagen, dass er unter dem politischen Personal der so prosaischen Bundesrepublik derjenige ist, der die Aura und das Charisma des ,Deutschland‘ von ehedem am meisten bewahrt hat.“ So urteilt Brigitte Sauzay in ihrem Tagebuch Retour à Berlin über Richard von Weizsäcker. Das „Deutschland von ehedem“? Was Sauzay, die mit Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing und François Mitterrand gleich drei französischen Staatspräsidenten als Dolmetscherin zur Seite stand, damit sagen will, erschließt sich dem deutschen Leser nicht auf Anhieb. Dieser Satz der französischen Deutschland-Kennerin richtet sich in erster Linie an ihresgleichen, germanophile Franzosen, die in Deutschland nicht nur die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik sehen, sondern eine Kulturnation, die sie seit jeher fasziniert hat. Diese Kulturnation hat eine politische Geschichte. Das „Deutschland von ehedem“ ist für Sauzay jenes Deutschland des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, dessen Tradition 1933 mit der Machteinsetzung Hitlers abriss.
Raymond Aron hat einmal über dieses Deutschland gesagt, es sei mehr noch als Großbritannien ein „Pionierland“ gewesen. Gegenüber dem amerikanischen Historiker Fritz Stern bemerkte er sogar, dass das 20. Jahrhundert „Deutschlands Jahrhundert“ hätte sein können. Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg führten jedoch zu einem Bruch, der sich nicht mehr rückgängig machen ließ. Für Brigitte Sauzay schlug Weizsäcker mit seiner Person und seinem Denken eine Brücke zurück zu diesem Deutschland. Ihr Urteil hat sie anlässlich des Erscheinens von Weizsäckers Erinnerungen Vier Zeiten formuliert und mit Blick auf jenes mysteriöse „Deutschland von ehedem“ hinzugefügt: „Es unter seiner Feder wiederzufinden ist ein großes Vergnügen.“
Obwohl das eine sehr französische Perspektive ist, dürften auch viele deutsche Zeitgenossen instinktiv erfasst haben, was Sauzay meinte. Weizsäcker haftete stets etwas an, das den Rahmen, in dem er sich bewegte, auf angenehme Weise sprengte. Schon auf Bildern aus seiner Anfangszeit im Bundestag ist es zu sehen: Er füllt den Raum um sich herum aus, ohne andere zu erdrücken. Haltung, Kleidung und Körpersprache verraten einen Mann, der sich voll und ganz dem politischen Geschäft zur Verfügung stellt, aber auch anderswo sein könnte. Von den beiden Begriffen, die Sauzay in ihrem Buch verwendet, eignet sich Aura besser dazu, diesen rahmensprengenden Habitus zu beschreiben. Charisma im soziologischen oder allgemeinsprachlichen Sinne einer Ausübung außergewöhnlicher Macht hatte Weizsäcker sicher nicht.
In Wirklichkeit verfügte er während seiner erst spät begonnenen politischen Laufbahn fast zu keiner Zeit über große politische Macht. Nachdem er 1969 erstmals in den Bundestag gewählt worden war, gehörte er der Opposition an; Regierender Bürgermeister von Berlin war er nur knapp drei Jahre lang, von 1981 bis 1984; und als Bundespräsident in den Jahren 1984 bis 1994 hatte er ein Amt inne, das im Wesentlichen auf das Repräsentative beschränkt ist. Immer jedoch und nicht erst im Amt des Bundespräsidenten kam ihm das zugute, was Sauzay als Aura bezeichnete: eine Ausstrahlung, die Autorität auch ohne konkrete Macht verheißt und dem Gegenüber Respekt abnötigt. Dass das nicht jedem gefiel, ist klar. Richtig ist zudem, dass Weizsäcker diejenigen, die mit ihm zu tun hatten, durchaus spüren ließ, dass er über diese Aura verfügte. Anders ausgedrückt, könnte man sagen, dass er ähnlich wie Helmut Schmidt, mit dem er in späteren Jahren befreundet war, seine intellektuelle Überlegenheit durchaus ausspielte.
Herkunft, Ausbildung und Beruf
Das spricht für eine Selbstsicherheit, die nicht ohne Voraussetzungen ist. Richard von Weizsäcker war der Spross einer aus Württemberg stammenden bildungsbürgerlichen Familie, deren Aufstieg am Ende des 18. Jahrhunderts begonnen hatte, als die Weizsäckers noch Müller waren, und seinen Höhepunkt erreichte, als Weizsäckers Großvater Karl Hugo 1906 Präsident des Staatsministeriums im Königreich Württemberg wurde, was dem Amt eines Ministerpräsidenten entspricht. Nachdem Karl Hugo von Weizsäcker den persönlichen Adel schon früher erworben hatte, wurde ihm 1916 – nur zwei Jahre vor dem Ende der Monarchie und der Abschaffung des Adels – der erbliche Titel eines Freiherrn verliehen. Richard von Weizsäcker war deshalb das erste Familienmitglied, das mit dem Titel geboren wurde, als er am 15. April 1920 im Stuttgarter Schloss das Licht der Welt erblickte.
Weizsäckers Vater war der Diplomat Ernst von Weizsäcker, von 1938 bis 1943 Staatsekretär im Auswärtigen Amt, der dem Nationalsozialismus zwar innerlich ablehnend gegenüberstand, aber aufgrund seiner Funktion in den Völkermord an den europäischen Juden verstrickt war. Im sogenannten Wilhelmstraßenprozess wurde Ernst von Weizsäcker am 14. April 1949 wegen seiner bürokratischen Mitwirkung am Holocaust zu fünf Jahren Haft verurteilt, von denen er nur 18 Monate verbüßen musste. Richard von Weizsäcker, der seinem Vater beim Prozess als Hilfsverteidiger zur Seite stand – noch war er Jurastudent in Göttingen und kein Anwalt –, hat immer daran festgehalten, dass das Urteil „historisch und moralisch ungerecht“ sei.
Ein Historiker muss den Fall Ernst von Weizsäcker mit der notwendigen Differenziertheit betrachten. Man wird Ernst von Weizsäcker nicht zum Nationalsozialisten erklären können; ebenso wenig kann man aber seine Involvierung in die Verbrechen des NS-Regimes übersehen. Für Richard von Weizsäcker war es einfacher: Ihm ging es um die Verteidigung des Vaters und der Familie, den Rest blendete er aus. Gleichzeitig – und dass macht die Richard von Weizsäcker seitdem immer anhaftende Ambivalenz aus – zog er aus diesem Prozess entscheidende historische Lehren. Die Nürnberger Prozesse beförderten in ihm das Bewusstsein, dass er schon im Zweiten Weltkrieg als Offizier an der Ostfront gewonnen hatte, als er Kontakte zum militärischen Widerstand gegen Hitler pflegte: das Bewusstsein für die deutsche Schuld und die Verantwortung, an sie zu erinnern.
Dieses Bewusstsein kulminierte in der berühmt gewordenen Rede, die er am 8. Mai 1985 als Bundespräsident zur Kapitulation des „Dritten Reichs“ im Westen hielt. Was Weizsäcker in dieser Rede feststellte, war nicht neu, aber noch nie hatte ein hoher Repräsentant des Staates, schon gar nicht der höchste, diese Dinge so deutlich ausgesprochen. Besonders bedeutsam war, dass er den 8. Mai 1945 einen „Tag der Befreiung“ nannte. Zu diesem Zeitpunkt war Weizsäcker seit fast einem Jahr Bundespräsident. Erst in diesem Amt war er völlig bei sich selbst; seine gesamte politische Karriere, die der Wahl zum Bundespräsidenten vorausging, wirkt in der Rückschau wie eine Vorbereitung auf das höchste Amt der Bundesrepublik.
Begonnen hatte diese politische Karriere freilich erst in fortgeschrittenem Alter. Nach Jurastudium und Promotion an der Universität Göttingen verpasste Weizsäcker – nicht ganz schuldlos – den Eintritt in den Staatsdienst als Richter. Auch eine wissenschaftliche Karriere, die der Familientradition entsprochen hätte und die sein acht Jahre älterer Bruder, der Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker, eingeschlagen hatte, war nicht nach seinem Geschmack. Stattdessen nahm er als erster in der Familie Weizsäcker eine Stelle in der Privatwirtschaft an und wurde Mitarbeiter beim Bergbau der Mannesmann AG in Gelsenkirchen. Dort lernte er Marianne von Kretschmann kennen, die er bald heiratete und mit der er vier Kinder bekam. In der Wirtschaft war Weizsäcker dann fünfzehn Jahre lang tätig, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung des pharmazeutischen Unternehmens C.H. Boehringer Sohn. 1966 schied er dort aus und ließ sich als Rechtsanwalt in Bonn nieder.
Protestantische Prägung und politisches Engagement
Parteipolitisch engagiert war Weizsäcker in diesen Jahren nicht. Zwar war er schon 1956 in die CDU eingetreten, aber passiv geblieben. An der CDU überzeugte ihn der Gedanke der Union zwischen Christen beider Konfessionen, aber auch die Verbindung liberaler, konservativer und sozialer Elemente. Mit dem C im Parteinamen hatte er dagegen Probleme, da er den damit verbundenen Anspruch für nur schwer erfüllbar hielt und das Christentum in der Politik nur als Inspiration, nicht aber als konkrete Handlungsrichtlinie gelten lassen wollte. Wenn er sich selbst als dezidiert politischen Protestanten verstand, so nur im Sinne einer protestantisch geprägten Verantwortungsethik, die den Christen zum Dienst an Staat und Gesellschaft verpflichtete, ihm aber keine inhaltlichen Vorgaben machte.
So betrachtete er auch das Amt des Präsidenten des Deutschen Evangelischen Kirchentags, dass er von 1964 bis 1970 und dann wieder von 1979 bis 1981 innehatte. Tatsächlich spielte die protestantische – vielleicht besser: kulturprotestantische – Prägung für Weizsäcker eine entscheidende Rolle. Anders als Helmut Kohl wäre er nicht auf die Idee gekommen, die CDU als seine „politische Heimat“ zu bezeichnen. Wenn er so etwas wie eine „politische Heimat“ hatte, dann war es der Protestantismus in der oben beschriebenen Weise. Gleichwohl war es Kohl, der Weizsäcker 1969 in die Politik holte, indem er ihm zu einem Bundestagmandat verhalf. Weizsäcker gehörte zu einer Gruppe von Seiteneinsteigern, mit deren Hilfe Kohl die CDU modernisieren wollte. Natürlich nahm Kohl auch deshalb im Frühjahr 1965 Kontakt zu dem bei Boehringer tätigen Weizsäcker auf, weil er für die rheinland-pfälzische CDU einen profilierten politischen Protestanten suchte, der noch dazu über einen klingenden Namen verfügte. Noch war Weizsäcker aber nicht bereit, den Schritt in die Politik zu tun, denn zunächst wollte er sein Ehrenamt als Kirchentagspräsident mit der gesamten Zeit und Kraft ausfüllen, die ihm seine berufliche Tätigkeit ließ. Kohl und Weizsäcker, die in vielen übereinstimmten, schieden in der festen Absicht voneinander, später einen gemeinsamen Versuch zu machen.
Zwar wurde Weizsäcker schon 1966 auf Kohls Vorschlag in den Bundesvorstand der CDU gewählt. Ein Kirchentagspräsident machte sich gut in diesen Gremien. Aber es dauerte zwei weitere Jahre, bis Weizsäcker sich zu einer ersten Kandidatur bereitfand, die allerdings einen ganz besonderen Charakter hatte. Im Sommer 1968 bat ihn der Generalsekretär der Bundes-CDU Bruno Heck, im kommenden März in der Bundesversammlung gegen Gustav Heinemann für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren, ein Ansinnen, dass Kohl nachdrücklich unterstützte. Weizsäcker erklärte sich schließlich zur Kandidatur bereit, unterlag aber dem von Franz Josef Strauß und Hans Filbinger unterstützten Kandidaten Gerhard Schröder, damals Bundesverteidigungsminister, in einer Kampfabstimmung der Parteivorstände und des Fraktionsvorstands von CDU und CSU.
Abgeordneter des Deutschen Bundestags
1969 gab Weizsäcker dann dem Werben der CDU nach und wurde über die rheinland-pfälzische Landesliste in den Bundestag gewählt. Innerhalb der CDU/CSU-Fraktion, zu deren stellvertretendem Vorsitzenden er 1972 gewählt wurde, profilierte er sich bald als rhetorisch brillanter Außenpolitiker, der in den Debatten um die Neue Ostpolitik der sozial-liberalen Regierung eine mittlere Linie zwischen der Regierung und den Hardlinern in der eigenen Fraktion vertrat. Das entsprach den Überzeugungen, die er als Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentags gewonnen hatte, als er an der Ausarbeitung der Ostdenkschrift der EKD beteiligt war. Ohne die von Konrad Adenauer erreichte Westbindung auch nur im Geringsten in Frage zu stellen, war er der Ansicht, dass angesichts der veränderten Politik der Westalliierten gegenüber der Sowjetunion die Zeit dafür gekommen war, dass die Bundesrepublik die Verbesserung der Beziehungen zu den Staaten des Warschauer Pakts, vor allem zu Polen, selbst in die Hand nehmen musste. Dazu gehörte es auch, den Vertriebenen nicht länger Hoffnung auf eine Rückkehr in ihre alte Heimat zu machen.
Am Ende gehörte Weizsäcker zu nur drei Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion, die im Jahr 1972 der Ratifizierung der Ostverträge zustimmten – aus reiner Vernunft, wie er meinte, denn ein Scheitern der mühsam ausgehandelten Verträge im Bundestag hätte die Bundesrepublik in eine ihren Interessen widersprechende Isolation unter den eigenen Verbündeten geführt. Man darf darin keine grundsätzliche Zustimmung zur Neuen Ostpolitik sehen, der Weizsäcker in Wirklichkeit mit großer Skepsis gegenüberstand. Egon Bahrs Formel vom „Wandel durch Annäherung“ lief in seinen Augen eher auf die Zementierung der Teilung hinaus. Weizsäcker sprach und handelte in diesen Jahren als Bundestagsabgeordneter immer aus einer gleichermaßen transatlantischen wie gesamtdeutschen Perspektive – von Standpunkt des nun verwestlichten „Deutschland von ehedem“ aus, wenn man so will. Das Ziel aller Bemühungen musste neben der notwendigen Aussöhnung mit den Nachbarn die Wiederherstellung der Einheit der Nation innerhalb der westlichen Wertegemeinschaft sein, auch wenn es dafür notwendig sein würde, auf die Ostgebiete zu verzichten.
Mit Sorge beobachte Weizsäcker den Vormarsch sozialistischer Auffassungen innerhalb der SPD und mit Ärger die Entwertung des Nationsbegriffs in den Reihen der Regierungsfraktionen. Im Bundestag sagte er dazu am 24. Februar 1972: „Ich meine, Nation ist ein Inbegriff von gemeinsamer Vergangenheit und Zukunft, von Sprache und Kultur, von Bewußtsein und Wille, von Staat und Gebiet. Mit allen Fehlern, mit allen Irrtümern des Zeitgeistes und doch mit dem gemeinsamen Willen und Bewußtsein hat diesen unseren Nationsbegriff das Jahr 1871 geprägt. […] Das ist bisher durch nichts anderes ersetzt. Leider aber haben wir im Jubiläumsjahr der Reichsgründung, also im letzten Jahr, stattdessen von hoher und besonders hoher Stelle andere, zumeist kritische Äußerungen zu dieser Nation gehört.“
Schärfung des liberalkonservativen Profils der CDU
So wie Weizsäcker in den Debatten um die Neue Ostpolitik den Nationsbegriff schärfte und verteidigte, warb er innerhalb der CDU dafür, die Partei auch als konservative Kraft zu begreifen. Tatsächlich war die Parteiprogrammatik das zweite große Feld, auf dem er sich in seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter profilierte. Im Dezember 1971 übernahm er auf Bitten des Bundesvorsitzenden Rainer Barzel den Vorsitz einer siebenköpfigen Grundsatzkommission, deren Arbeit schließlich, ohne dass es am Anfang beabsichtigt gewesen wäre, im Jahr 1978 zur Verabschiedung eines neuen Grundsatzprogramms auf dem Ludwigshafener Parteitag führte. In diesen Jahren entfaltete Weizsäcker seine Ansichten auf allen Politikfeldern und zeigte nicht zuletzt auf dem Gebiet der Familienpolitik eine konservative Neigung. Wenn er jedoch in diesen Jahren auch öffentlich ein ums andere Mal auf den Wert des Konservatismus hinwies, dann hatte er dabei vor allem eine konservative Disposition vor Augen.
Sein britisches Verständnis eines Konservatismus innerhalb des liberalen Systems unterbreitete er der Öffentlichkeit schon im Februar 1971 in der Süddeutschen Zeitung. Dort kritisierte er Bundeskanzler Willy Brandt dafür, dass er Politikern, „die in überwiegend konservativem Denken beharren“ unterstellt hatte, sie seien zu Reformen unfähig, und fügte hinzu: „Meine Gegenthese lautet: Gute Erneuerer sind nur die, denen es gelingt, sich für ihre Veränderungen der Konservativen zu bedienen. Eine gute konservative Partei aber ist nur die, welche die notwendigen Erneuerungen selbst in die Tat umsetzt.“ Bewahrung und Reform gehörten für Weizsäcker zusammen. Das war ihm so wichtig, dass er es später in seinen Erinnerungen fast wörtlich wiederholte. Dort berief er sich dabei, wie viele im deutschsprachigen Raum, auf Benjamin Disraeli, obwohl Edmund Burke, George Canning und Sir Robert Peel die weit wichtigeren Gewährsmänner für diese Art des Liberalkonservatismus sind.
Jedenfalls ließ er auf dem Hamburger Bundesparteitag von 1973 keinen Zweifel daran, dass er neben der Österreichischen Volkspartei mit „ihrem vorbildlichen Grundsatzprogramm“ vor allem die „englischen Konservativen“ als Vorbild betrachtete, diese „im besten Sinne wahrhaft fortschrittliche[…] Partei.“ Zugleich warb er auf demselben Parteitag für eine „verantwortete Freiheit“ – ein Begriff der nicht zufällig an die „manly, moral, regulated liberty“ erinnerte, von der Burke in seinen Reflections on the Revolution in France geschrieben hatte: „Freiheit bedeutet nicht nur Individualismus, sondern praktizierte Nachbarschaft, nicht nur Kritikfähigkeit, sondern auch die Fähigkeit zum Vertrauen, nicht nur Emanzipation, sondern auch Bindung, und nicht nur weltanschaulichen Pluralismus, sondern Anerkennung der für die Gesellschaft grundlegenden sittlichen Wertordnung.“ Schon in den 1970er Jahren arbeitete Weizsäcker also an jenem liberalkonservativen Profil, das seine Präsidentschaft prägen sollte.
Regierender Bürgermeister von Berlin
Bevor es so weit war, nutze er die Chance, erstmals in ein exekutives Amt zu gelangen. 1978 bot ihm der West-Berliner CDU-Landesverband die Kandidatur für das Amt des Regierenden Bürgermeisters an. Weizsäcker akzeptierte es umso lieber, als er Berlin als seine eigentliche Heimat betrachtete. Als Sohn eines Diplomaten war er in seiner Jugend oft umgezogen, hatte aber in Berlin prägende Jahre verbracht.
In den Wahlen von 1979 unterlag die CDU noch der SPD, aber in den vorgezogenen Wahlen von 1981 erreichte sie dann mit 48 Prozent fast zehn Prozent mehr als die SPD, so dass Weizsäcker zunächst einen Minderheitssenat bilden und schließlich, nach dem Machtwechsel in Bonn von 1982, eine Koalition mit der FDP eingehen konnte. In seinem neuen Amt zeigte er, dass er es vermochte, ganz verschiedene Dinge auszubalancieren und vor allem die ganze Breite der Volkspartei CDU zur Geltung kommen zu lassen.
Bundespräsident
Trotz der Beliebtheit, die er sich bald erworben hatte, zog es ihn 1984 ins Amt des Bundespräsidenten. 1974 hatte er, in vollem Bewusstsein, nur ein Zählkandidat zu sein, für die CDU/CSU gegen Walter Scheel kandidiert. Umso wichtiger war es dem durchaus ehrgeizigen Weizsäcker nun, endlich selbst zum Zuge zu kommen. Gegen gewisse Widerstände in der eigenen Partei setzte er seine Kandidatur durch und siegte in der Bundesversammlung mit 80 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen die von den Grünen unterstützte Schriftstellerin Luise Rinser. Es war nicht überraschend, dass Weizsäcker angesichts dieses Ergebnisses die ohnehin vom Amt vorgegebene Pflicht zur Überparteilichkeit besonders ernstnahm. Freilich war er zwar ein überparteilicher, aber kein politisch neutraler Präsident. Vor allem die Kritik an der „Machtversessenheit“ der Parteien, die er in seiner zweiten Amtszeit und nach dem Ausscheiden aus dem Amt übte, hat nicht nur Zustimmung erfahren, sondern auch in den eigenen Reihen für Irritationen gesorgt.
Inhaltlich hielt er an seinen Schwerpunkten fest, setzte sich für die Aussöhnung mit dem polnischen Nachbarn ein, untermauerte die Verankerung der Bundesrepublik in Europa und der atlantischen Gemeinschaft und mahnte zum gesellschaftlichen Zusammenhalt im Sinne der „verantworteten Freiheit“. Er festigte damit seinen Ruf als „idealer Liberalkonservativer“, wie ihn der schon erwähnte Fritz Stern zwei Jahre nach seinem Tod in einem Interview bezeichnete. Weizsäckers Stärke lag vor allem auf dem durch eine geschliffene Rhetorik vermittelten politischen Denken. Während dieser ersten Amtszeit erwarb er sich so großes Ansehen, dass er bei seiner Wiederwahl im Mai 1989 keinen Gegenkandidaten hatte. Zu erklären war das auch damit, dass Weizsäcker genau dem Bild entsprach, dass sich die politisch interessierten Bundesbürger von einem Staatsoberhaupt machten. Die ZEIT-Herausgeberin Marion Gräfin Dönhoff hat dazu einmal geschrieben: „Wenn man einen idealen Bundespräsidenten synthetisch herstellen könnte, dann würde dabei kein anderer als Richard von Weizsäcker herauskommen.“
Nach der Wiedervereinigung konnte Weizsäcker als erster gesamtdeutscher Bundespräsident auch die Ostdeutschen für sich einnehmen. Seinem über die Bundesrepublik hinausgehenden Verständnis der deutschen Nation entsprechend verlegte er bereits im Januar 1994 den ersten Amtssitz des Bundespräsidenten von Bonn nach Berlin. Schon 1990 hatte er die Deutschen gemahnt, zu bedenken, dass Vereinigung auch Teilen bedeuten werde.
Gleichzeitig patriotisch und weltläufig, aristokratisch und bürgerlich, anglophil und im besten Sinne preußisch – so lässt sich Weizsäckers Profil als Bundespräsident beschreiben. Der Bewunderer Friedrichs des Großen warb stets für Toleranz, das Verbindende, den Kompromiss und den Ausgleich. Das galt auch für die deutsche Geschichte. Es gelang ihm – nicht nur in seiner Rede vom 8. Mai 1985 – die Brüche der deutschen Geschichte sichtbar zu machen, ohne die Kontinuitäten zu verdecken. Die durch das Grundgesetz geschaffene Bundesrepublik war das Ergebnis einer langen Geschichte, die man nicht ausblenden konnte. Der am 31. Januar 2015 in Berlin verstorbene Weizsäcker versöhnte die Deutschen im Rahmen des Möglichen mit dieser Geschichte, ohne sie aus der Verantwortung für die Verbrechen des „Dritten Reichs“ zu entlassen. Das ist kein geringes Verdienst. Seine Beliebtheitswerte während und nach der Präsidentschaft zeigen, dass die Deutschen es ihm gedankt haben.
Lebenslauf
- 1937 Abitur
- 1937-38 Studium in Oxford und Grenoble
- 1938–1945 Militärdienst
- 1945–1949 Studium der Rechtswissenschaften und Geschichte in Göttingen
- 1956 Eintritt in die CDU
- 1964–1970 und 1979-1981 Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages
- 1967-1984 Mitglied der Synode und des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland
- 1969–1981 Mitglied des Deutschen Bundestages
- 1981–1984 Regierender Bürgermeister von Berlin
- 1984–1994 Bundespräsident
- 1994-2014 Vorsitzender des Bergedorfer Gesprächskreises der Körber-Stiftung
- 1994-2015 Kuratoriumsvorsitzender der Theodor-Heuss-Stiftung
- 1999-2000 Leiter der „Kommission gemeinsame Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr“
- 2004-2005 deutscher Vertreter der „Internationalen Balkan-Kommission“.