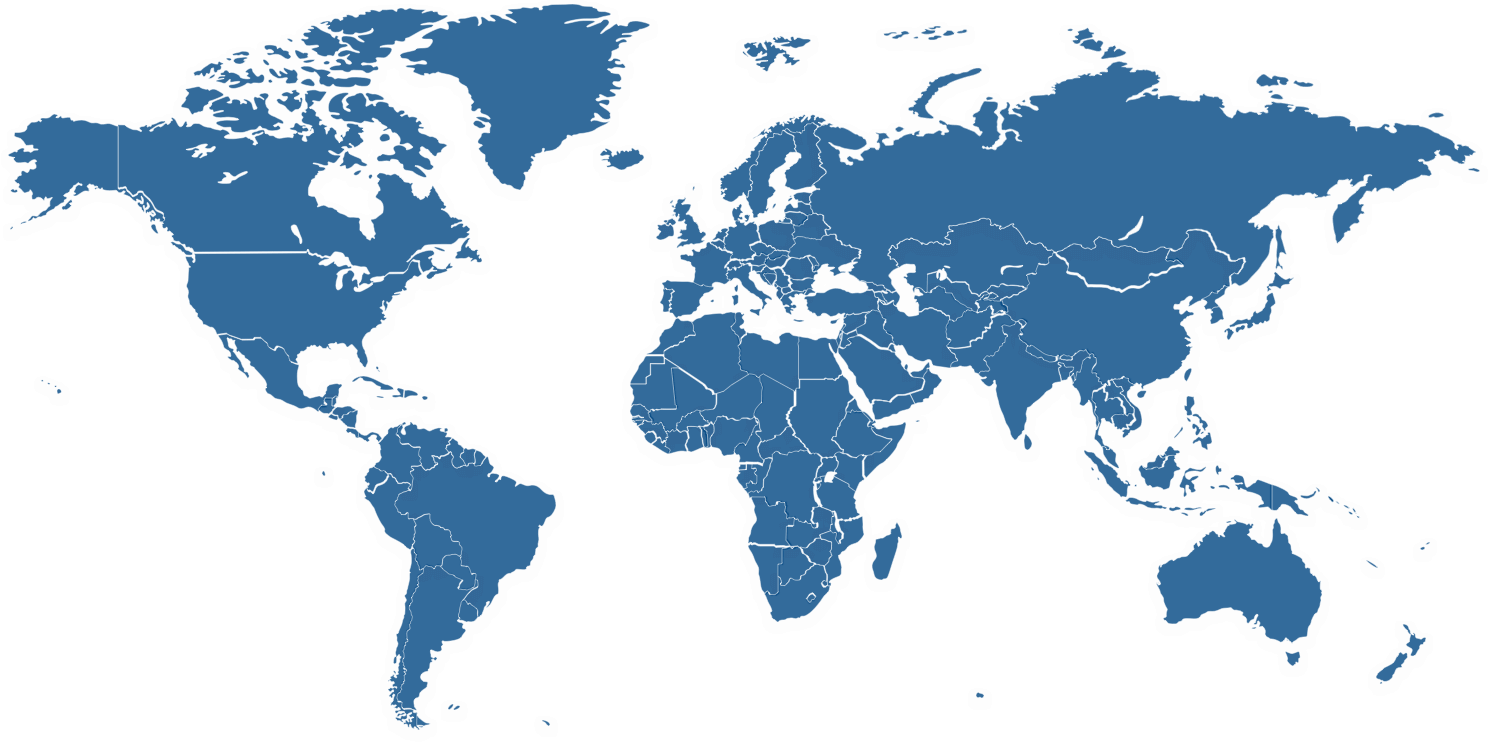Die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) sieht sich in Deutschland seit einiger Zeit in einer polarisierenden Debatte, die auch die breitere Öffentlichkeit erreicht hat. So gab es etwa hitzige und wenig konstruktive Diskussionen über „Radwege in Peru“.
Nach der vorgezogenen Bundestagswahl, inmitten einer internationalen Wirtschaftskrise, geopolitischer Verwerfungen und infolge des massiven, abrupten Rückzugs der USA unter Donald Trump aus der internationalen EZ ist ein Blick auf andere EZ-Geber interessant: Was machen Akteure wie China, das sich innerhalb kurzer Zeit vom Empfängerland zu einem der wichtigsten globalen Geberstaaten entwickelt hat, anders – oder auch besser – als Deutschland und andere europäische Länder? Kann Deutschland von einem Land wie der Volksrepublik China in Sachen Entwicklungspolitik etwas lernen oder ist allein der Gedanke verwerflich – angesichts der autokratischen Verfasstheit des Landes, angesichts eines völlig anderen wirtschaftlichen und politischen Systems?
Chinas Entwicklungszusammenarbeit (EZ), die als „Süd-Süd-Kooperation“ bezeichnet wird, verbindet entwicklungspolitische und kommerzielle Maßnahmen, wobei Umwelt- und Menschenrechtsstandards oft vernachlässigt werden. Ein bekanntes Beispiel ist die Belt and Road Initiative (BRI), die Handelsrouten ausbaut und strategische Rohstoffe sichert. China stellt den Partnerländern günstige Kredite zur Verfügung, die diese nicht bedienen können und sich in der Folge hoch verschulden. Großaufträge werden häufig an chinesische Staatskonzerne vergeben. Dagegen entsteht wenig Wertschöpfung im Partnerland.
Chinas EZ ist geprägt von einem materialistischen Entwicklungsverständnis, bei dem wirtschaftliche Rechte über Menschen- und Bürgerrechte gestellt werden. Diese Sichtweise versucht China auch in multilaterale Organisationen einzubringen, um internationale Menschenrechtsstandards aufzuweichen.
Bei aller berechtigten Kritik an den skizzierten Problemfeldern könnte Deutschland dennoch von Chinas pragmatischer Herangehensweise lernen, stärker auf die Bedürfnisse und Prioritäten der Partnerländer einzugehen und schneller attraktivere Angebote zu machen. Dies könnte die Förderung wirtschaftlicher Entwicklung umfassen, was derzeit kein Schwerpunkt der deutschen EZ ist. Dabei könnten auch deutsche Unternehmen künftig stärker in deutsche und europäische EZ-Projekte eingebunden werden. Gleichzeitig sollte Deutschland in Abstimmung mit der EU sein entwicklungspolitisches Handeln strategischer und sowohl werte- als auch interessengeleitet ausrichten: Zugang zu Rohstoffen, Klimaschutz oder Sicherheitsinteressen sind hier wichtige Aspekte. Dies würde die Glaubwürdigkeit erhöhen und den Rückhalt in der eigenen Bevölkerung stärken.
Wichtig ist jedoch, dass Deutschland weiterhin auf Werte wie Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit achtet, ohne diese den Partnerländern als Gegenleistung für Hilfsgelder aufzuzwingen. Vielmehr sollte es die Vorteile eines nachhaltigen Entwicklungsansatzes aufzeigen und durch Überzeugung, also soft power, statt durch Auflagen agieren.
Lesen Sie den gesamten Monitor: „Chinas Rolle in der Entwicklungszusammenarbeit“ aus unserer Reihe Nachhaltigkeit hier als PDF.
Temas
Sobre esta serie
Las publicaciones del Monitor Sostenibilidad forman parte de nuestra serie de publicaciones Monitor. La serie Monitor ofrece una visión clara de un tema clave desde la perspectiva de los expertos de la KAS y lo sitúa en un contexto político y social mediante algunos «puntos clave».