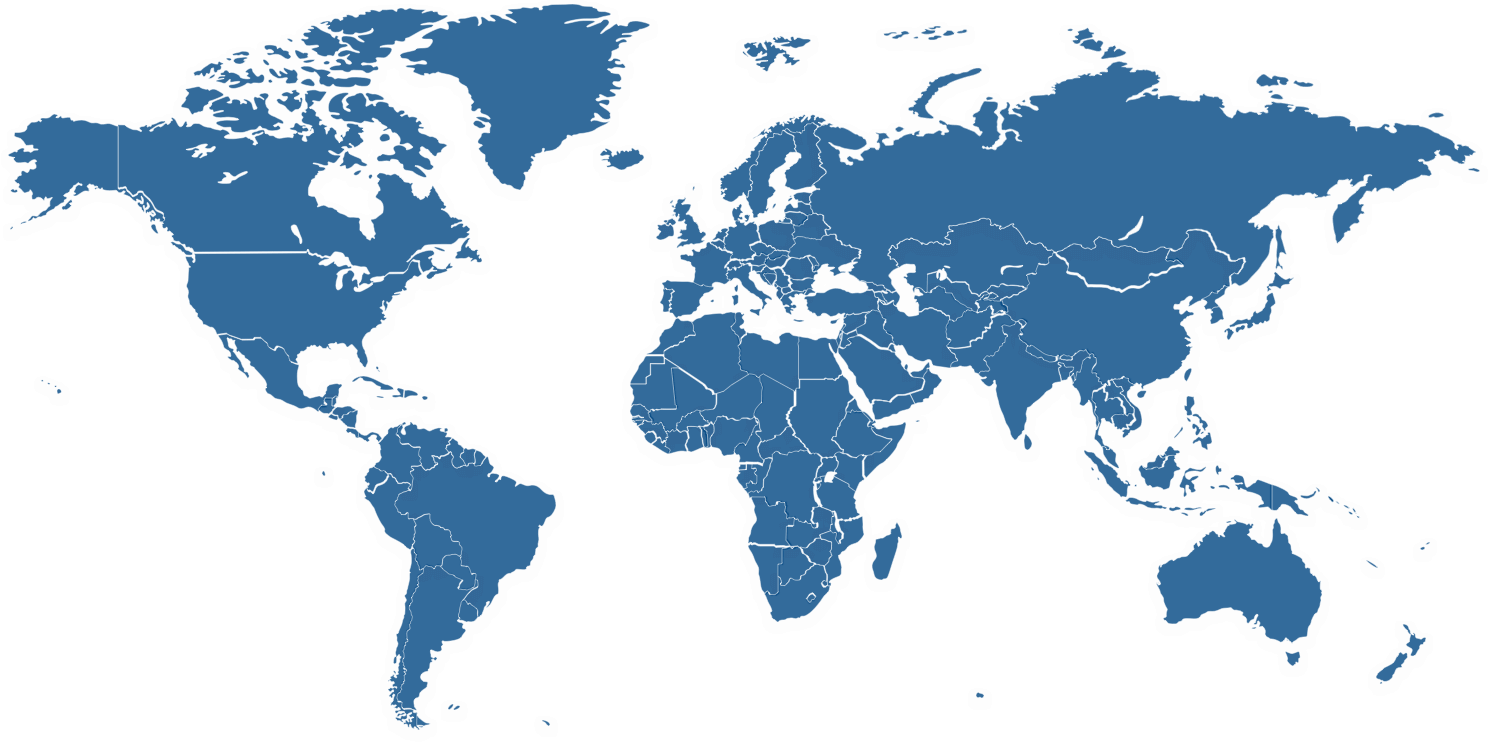Menschen protestieren...
Es kann als ein bemerkenswerter Ausdruck der Widerstandsfähigkeit der georgischen Zivilgesellschaft gewertet werden, dass die Proteste gegen den europafeindlichen und anti-demokratischen Kurs der Regierung des Georgischen Traums trotz der kalten Jahreszeit anhalten und weiterhin auch landesweit stattfinden. Zwar fehlen der Protestbewegung immer noch prägende Stimmen oder Gesichter, das ist aber auch eine Vorsichtsmaßnahme, denn sobald Anführer sichtbar werden, setzt die Regierung alles daran, diese aus dem Verkehr zu ziehen. Dafür tauchen immer wieder „Partisanen-Elemente“ während der Proteste auf, die die internationale Aufmerksamkeit auf die Situation in Georgien hochhalten: Im Januar wurden Fahrkartenautomaten in Tiflis manipuliert, so dass beim Kauf eines Tickets pro-europäische oder regierungskritische Ansagen ertönten.
Die Forderungen der Protestierenden bleiben unterdessen unverändert: Neuwahlen und die Freilassung der weit über hundert politischen Inhaftierten, die seit Wochen festgehalten werden. Bei beiden Punkten zeigt die Regierung bislang keinerlei Anzeichen des Einlenkens, im Gegenteil, es mehren sich Berichte über Essensentzug in Haft, physische Misshandlungen und Androhungen sexueller Gewalt gegen Gefangene. Die gut dokumentierten Fälle tragen dazu bei, dass der internationale Druck auf die Regierung wächst: Die USA haben zuletzt Sanktionen gegen Iwanischwili verhängt und die EU die Visumsfreiheit für georgische Diplomaten aufgehoben. Noch scheinen diese Schritte allerdings nicht ausreichend, um den Georgischen Traum zu Zugeständnissen zu bewegen.
...die Regierung schlägt zurück
Zu Beginn der Proteste im Dezember letzten Jahres folgte die staatliche Reaktion einem berechenbaren Muster: Protestierende wurden mit Wasserwerfern, Tränengas, gepanzerter Bereitschaftspolizei und irregulären Schlägertrupps verfolgt. Die Fotografin Gela Megrelidze berichtete nach ihrer Festnahme, dass alle Personen, die auf die Polizeiwache gebracht wurden, deutliche Anzeichen von Misshandlungen aufwiesen. Mittlerweile hat die Regierung ihr Vorgehen verändert. Die breitflächige Gewalt ist verschwunden, die Proteste werden ignoriert, und man gibt sich große Mühe, den Anschein von Normalität zu vermitteln. Dabei gehen die Repressionen allerdings weiter, einerseits selektiv gegen Einzelpersonen wie den ehemaligen Ministerpräsidenten Giorgi Gacharia, der von einem Parlamentsabgeordneten des Georgischen Traums und wahrscheinlich auf persönliche Anweisung von Iwanischwili in Batumi zusammengeschlagen wurde und mit gebrochener Nase im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Bilder des blutüberströmten Gacharia waren bewusst erniedrigend und offenbaren ein „russisches Vergeltungsmuster“: Gegner, die protestieren, werden schikaniert, aber Menschen, die dich verraten, müssen bestraft werden, und zwar sichtbar. Dass Gacharia, der unter Iwanischwili bis 2021 in Georgien zunächst als Innenminister und später als Ministerpräsident regierte, jetzt sein prominentester Kritiker ist, ist unverzeihlich. Der Vorfall in Batumi ist noch eine milde Strafe: Putin lässt Verräter umbringen.
Andererseits gehen die öffentlichen Proteste weiter, und die Regierung versucht, ihnen durch neue Gesetze die Dynamik zu nehmen. Vermummungen oder die Nutzung von Laserpointern und Feuerwerkskörpern sind verboten worden, Bußgelder für Verstöße wie das Blockieren von Straßen wurden drastisch erhöht. Gleichzeitig gab es bislang noch kein einziges Verfahren gegen Polizeibeamte oder irreguläre Sicherheitskräfte, obwohl deren Übergriffe in Bild- und Videomaterial umfassend dokumentiert sind. Auch der Abgeordnete, der Gacharia zusammenschlug, wurde nicht angeklagt. Damit wird signalisiert, dass Gewalt, wenn sie von der Regierung ausgeht, toleriert oder sogar gefördert wird. So entsteht in der Bevölkerung ein Gefühl von umfassender staatlicher Willkür bei gleichzeitig überwältigender individueller Rechtlosigkeit.
Msia Amaghlobeli
Teil der Strategie des Georgischen Traums ist es, dass unklar bleibt, wen es als nächsten trifft. Wie im Fall von Msia Amaghlobeli, der Gründerin der unabhängigen Zeitung Batumelebi und des Online-Nachrichtenportals Netgazeti. Msia ist seit Jahrzehnten eine der prominentesten Verfechterin der Pressefreiheit in Georgien und als solche ein Dorn im Auge des Georgischen Traums. Am 11. Januar wurde sie in Batumi während einer Protestaktion bei der Anbringung eines Plakates für ein administratives Vergehen festgenommen, jedoch schnell wieder freigelassen. Kurz darauf und noch vor der Polizeiwache kam es zu einer Auseinandersetzung mit Irakli Dgebuadze, dem Polizeichef von Batumi. In einer unübersichtlichen Situation, bei der verbale Beleidigungen und persönliche Anwürfe eine Rolle spielten, ohrfeigte die zierliche Amaghlobeli den sehr viel größeren Dgebuadze. Sie wurde wegen Angriffs auf einen Polizeibeamten festgenommen und nun schon eines strafrechtlichen Vergehens bezichtigt, was eine Haftstrafe von vier bis sieben Jahren nach sich ziehen kann. Die Festnahme wurde von einem lokalen Gericht bestätigt. Dabei gibt es Videomaterial, das zeigt, wie Dgebuadze weit vor ihrer Verhaftung ankündigt, Amaghlobeli „ins Gefängnis zu bringen“. Der Zwischenfall war eine offensichtliche Inszenierung, die das perfide Ineinandergreifen von Strafverfolgung und Justiz sowie die allumfassende politische Instrumentalisierung der Rechtsstaatorgane in Georgien zeigt.
Die Gegenüberstellung spricht für sich: Ein Parlamentsabgeordneter der Regierungspartei schlägt einen ehemaligen Regierungschef zusammen und befindet sich auf freiem Fuß, eine kritische Journalistin ohrfeigt einen Polizisten, und ihr drohen mehrere Jahre Gefängnis. Kaum jemand in Georgien zweifelt daran, dass diese Orchestrierungen von Bidsina Iwanischwili persönlich abgesegnet wurden. Die Fälle zeigen das Ausmaß, in dem Georgien zu einem „captured state“ geworden ist, ein Land als Geisel einer einzelnen Person, eines Oligarchen von zumindest mentaler russischer Provenienz, der offensichtlich vor allem von Macht und Geld getrieben ist.
Seit dem 12. Januar befindet sich Msia Amaghlobeli im Hungerstreik und scheint entschlossen, bis zum Ende zu gehen. Sie habe, so ihre Mitarbeiterinnen, es kommen sehen, dass sie inhaftiert würde, und jetzt sei sie bereit, ein Opfer zu bringen, wenn es ihrem Land helfe. Die Solidarität mit Msia Amaghlobeli ist groß, eine Koalition von 14 europäischen Staaten fordert über die Botschaften in Georgien ihre sofortige Freilassung.
„Reorganisatorische“ Säuberungswellen
Ein weiteres Element des Umbaus Georgiens von einer sich entwickelnden europäischen Demokratie zu einer sich konsolidierenden eurasischen Autokratie sind politische Säuberungswellen in der staatlichen Verwaltung. Seit Wochen werden Angestellte, Lehrkräfte und andere Staatsbedienstete unter fadenscheinigen Gründen im Rahmen einer nur oberflächlich als „Reorganisation“ getarnten systematischen Durchkämmung des Apparates nach kritischen Stimmen entlassen. Nino Tkeschelaschwili etwa, die als Abteilungsleiterin im Justizministerium ihre Arbeit verlor, nachdem sie Ende November eine Petition gegen die von Ministerpräsident Kobachidse verkündete Aussetzung der EU-Annäherungsprozesses unterzeichnet hatte. Ihre Entlassung wurde durch ein neues Gesetz erleichtert, das den Schutz vor Kündigungen im öffentlichen Dienst aufweicht und es einfach macht, politisch unliebsame Personen zu entfernen. Die Säuberungswelle trifft nicht mehr nur höhere Beamte, sondern zieht sich durch viele staatliche Institutionen.1 Giga Sopromadze, Koordinator für Programme zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen in der Stadtverwaltung von Tiflis, wurde nach der Unterzeichnung eines regierungskritischen Aufrufes entlassen mit der Begründung, alle behindertenbezogenen Programme seien umgesetzt, seine Arbeit werde somit nicht mehr benötigt.
Warten auf ein Wunder...
International schreitet unterdessen die Isolation Georgiens weiter voran: Das Land verließ die Parlamentarische Versammlung des Europarats, nachdem die georgische Regierung dort zuvor mit überwältigender Mehrheit aufgefordert worden war, die Parlamentswahlen vom Oktober wiederholen zu lassen. Auch wenn diese Forderung im Regierungslager bislang nicht einmal erwogen zu werden scheint, ist sie ein mögliches Auswegszenario. Was die (verfassungs)rechtlichen Voraussetzungen wären und wie die Abhaltung von Neuwahlen im Einzelnen aussehen könnte, versucht ein von der KAS-Südkaukasus in Auftrag gegebenes Konzeptpapier aufzuzeigen. Beschrieben werden dabei zwei Optionen, eine Wahlwiederholung („re-run elections“) oder außerordentliche Neuwahlen. Gleichzeitig müssten eine neutrale Aufsicht über die Abhaltung der Wahlen garantiert und die maßgeblichen Institutionen – die zentrale Wahlkommission, die Generalstaatsanwaltschaft, der staatliche Sicherheitsdienst, das Antikorruptionsbüro und der Datenschutzdienst – frei von politischer Einflussnahme gehalten werden. Bislang gibt es weder auf diese erste Skizze eines Auswegs aus der politischen Sackgasse eine Reaktion, noch vermochte die Opposition ein eigenes oder alternatives Konzept dafür vorzulegen, wie das bestehende Patt aufzulösen wäre. Ghia Nodia, seit Jahrzehnten einer der klügsten Beobachter der georgischen Politik, beschrieb es so, dass das ganze Land auf ein Wunder warte, das vom Himmel falle und den gordischen Knoten durchtrenne, der Georgien gegenwärtig gefangen hält.
...oder auf Trump
Auf der anderen Seite fragen sich viele Beobachter, welches Ziel der Georgische Traum verfolgt oder genauer: was Iwanischwili mit der repressiven Politik tatsächlich beabsichtigt, die ursächlich zu der beschriebenen internationalen Isolation führt. Anfang des Jahres hieß es noch, die Regierung und der Oligarch würden auf den Amtsantritt von Donald Trump in den USA warten, von dem sie sich erhofften, dass ein Neustart der Beziehungen Georgiens mit dem Westen möglich werde. In der Tat ist das von Trump verfügte Einfrieren der weitgehend von USAID verwalteten amerikanischen Entwicklungshilfe ein schwerer Schlag für die georgische Zivilgesellschaft, die ihre Widerstandskraft nicht unwesentlich auch amerikanischer Unterstützung zu verdanken hat. Regierungsnahe Medien werden folglich auch nicht müde, diese Entscheidung zu preisen. Andererseits ist offensichtlich, dass die Trump-Administration gegenwärtig und auf absehbare Zeit mit anderen Dingen befasst ist als mit Georgien oder dem Südkaukasus. Abgesehen davon gehört der republikanischen Kongressabgeordnete Joe Wilson seit Wochen zu den schärfsten Kritikern der Situation in Georgien, er betont die offensichtlichen Konvergenzen des Georgischen Traums mit chinesischen, iranischen und russischen Interessen und setzt sich in Washington und auch international aktiv dafür ein, die bereits bestehenden Sanktionen gegen Iwanischwili auszuweiten.
Unbeirrbarer Optimismus
Seit Oktober 2023 setzt die KAS mit Partnern in Georgien ein EU-Projekt unter dem Titel „United for Georgia’s European Way“ um. Wir hätten nicht gedacht, dass es ein Jahr später praktisch keine Einigkeit in Georgien in Bezug auf Europa mehr gibt und der europäische Weg für das Land derart fundamental versperrt scheint. Und dennoch: Am Wochenende fand im Rahmen des Projektes ein Seminar für Lehrerinnen und Jugendarbeiter in Kutaisi in Westgeorgien statt. Es wurde über die aktuellen Herausforderungen, aber auch über historische Bezüge für Georgiens Verbindungen nach Europa diskutiert. Darüber, dass das Land in seiner Geschichte eigentlich immer nach Europa strebte. Gastgeber war eine lokale NGO, die seit bald zwei Jahrzehnten für ein demokratisches und europäisches Georgien arbeitet, immer wieder auch mit der Unterstützung von europäischen und amerikanischen Freiwilligen. Eine der Leiterinnen erzählte von den Schikanen, die sie und ihre Familie seit Monaten ausgesetzt seien, von anonymen Anrufen, Drohungen, Beschädigungen am Auto, Einbruchversuchen in die Räume der NGO. Auf die Frage, wie ihre Stimmung insgesamt sei, sagte sie, sie sei optimistisch, auch wenn es sich um einen Langstreckenlauf handele und das Ziel noch nicht in Sicht sei. Dass man das Ziel aber erreichen werden, daran habe sie keine Zweifel.
1 Siehe dazu auch den Beitrag auf OC Media, Fired for speaking out — the ‘cleansing’ of Georgia’s civil service