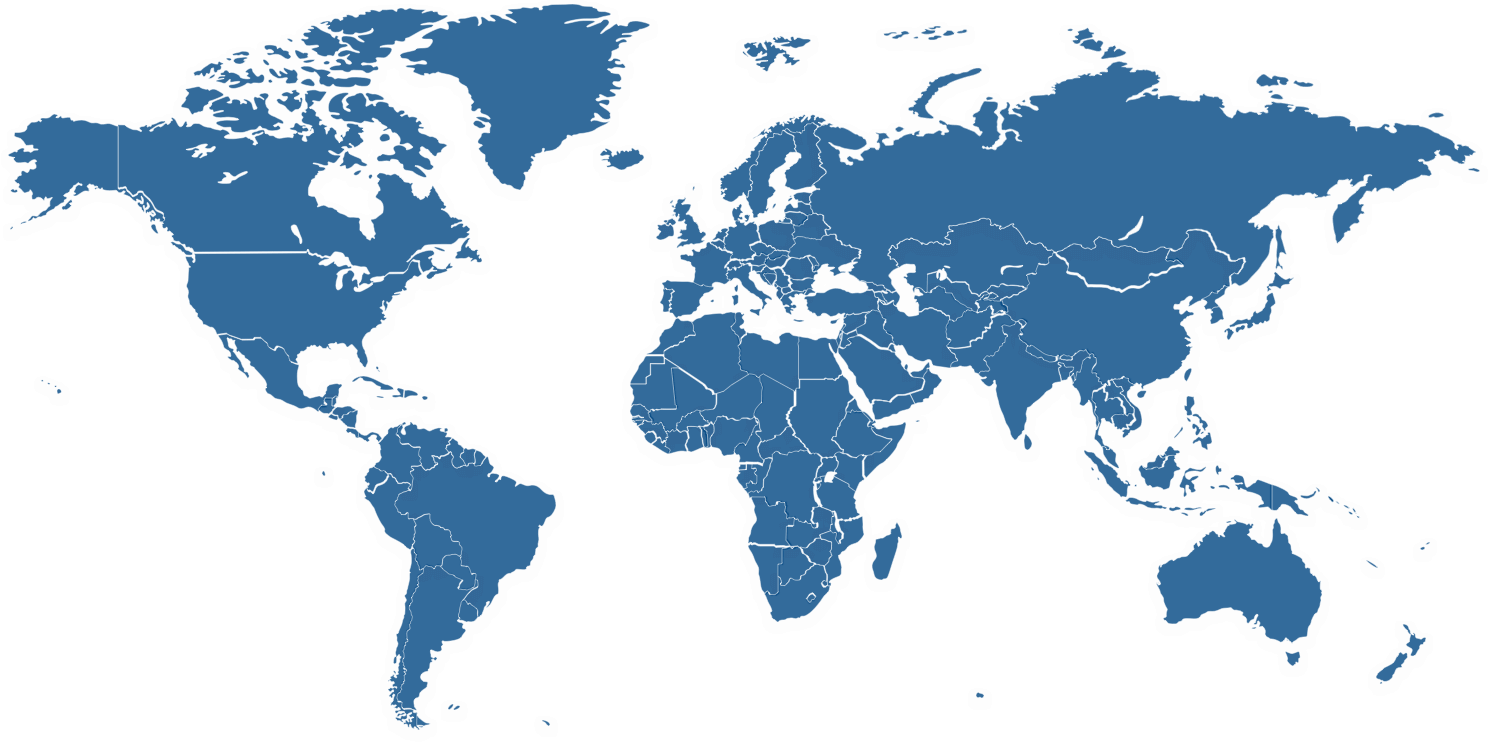דוח אירועים
Autoren: Jakob Ohm & David Dessauer
Die Konrad-Adenauer-Stiftung Israel und das Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA) widmeten sich im Rahmen ihrer gemeinsamen Jahreskonferenz einem besonderen zeitgeschichtlichem Datum - dem 100. Jahrestag des Sykes-Picot-Abkommens, das am 16. Mai 1916 zwischen den französischen und britischen Regierungen unterzeichnet wurde. Gemeinsam mit Experten unterschiedlicher Disziplinen analysierten die Organisatoren das schwierige Erbe der vor 100 Jahren am „grünen Tisch“ getroffenen Entscheidungen. Folgende Fragen waren dabei leitend: Welchen Anteil haben die Ereignisse vor 100 Jahren an den heutigen Zuständen im Nahen Osten? Wie sehr hat die Ziehung willkürlicher Grenzen und die Bildung von Nationen, die es vormals nicht gegeben hat, zum Phänomen des Mächte- und Kräftezerfalls vor Ort und der Herausbildung neuer nichtstaatlicher Akteure beigetragen? Welche Lehren, wenn überhaupt, kann der "Westen" kann die internationale Gemeinschaft heute aus "Sykes-Picot" ziehen? Wie kann und soll die internationale Gemeinschaft im Nahen Osten in Zukunft politisch, ökonomisch, militärisch "eingreifen"? Was bedeutet das alles für Israel?
Dr. Michael Borchard, Leiter des KAS-Büros in Israel, konnte rund 300 Gäste und 20 Experten begrüßen, die sich in vier Podien unterschiedlichen Aspekten der Thematik widmeten. Er betonte in seiner Eröffnungsansprache besonders deutlich, dass das Sykes-Picot Abkommen nicht gleichzusetzen sei mit dem „Beginn allen Übels“, deutete jedoch darauf hin, dass beispielsweise nur wenige Zeit nach Unterzeichnung des Abkommens die oft unterschätzte Muslimbruderschaft gegründet wurde. Dr. Borchard stellte dar, dass die Ziele der britischen und französischen Diplomaten Mark Sykes und François Georges-Picot ursprünglich nicht auf die Grenzziehung, sondern viel mehr auf die Festlegung von Einflusszonen ausgerichtet waren. Daher reiche eine rein geschichtliche Analyse dieses Abkommens und dessen Folgen nicht aus.
Es folgten die Grußworte des Konferenzleiters auf Seiten des JCPA, Amb. Freddy Eytan, in dessen Rahmen er auf die nicht immer unkomplizierte Zusammenarbeit mit europäischen Partnern im Nahen und Mittleren Osten verwies. Er legte die religiösen Spannungen zwischen Schiiten und Sunniten dar und betonte die Notwendigkeit, geschlossen gegen den „Globalen Jihad“ vorzugehen. Für einen stabilen Frieden in der Region seien jedoch direkte Gespräche zwischen den Konfliktparteien unerlässlich.
Panel 1: Historischer Überblick zum Sykes-Picot-Abkommen
Das erste Podium zum historischen Hintergrund des Sykes-Picot Abkommens eröffnete Prof. Shlomo Avineri, Politikwissenschaftler an der Hebräischen Universität von Jerusalem. Prof. Avineri begann mit der Darstellung der Ausgangslage des Nahen Ostens nach Ende des Ersten Weltkriegs und der damit einhergehenden geopolitischen Herausforderungen. Als Beispiel für die Langzeitfolgen des europäischen Einflusses im Nahen Osten nannte er die Bestrebungen der Kurden im Irak nach einem eigenen Staat. Bezugnehmend auf die jüngeren historischen Ereignisse stellte Avineri fest, dass der Optimismus, der vom Arabischen Frühling ausgegangen war, einem bitteren Realismus von Terror und Gewalt gewichen sei.
Als zweiter Redner stellte Nahostexperte des Shalem College, Martin Kramer, die Machtansprüche im Nahen Osten zur Zeit des Sykes-Picot Abkommens unter dem Aspekt der Errichtung eines unabhängigen arabischen Staates dar. Während seiner Ausführungen stellte er heraus, dass dieses Konstrukt jedoch im Widerspruch zur zionistischen Idee stand.
Als dritter Referent vermittelte Efraim Karsh, Professor für Politikwissenschaften an der Bar-Ilan Universität und Professor am King`s College in London, die britische Perspektive auf die historischen Ereignisse rund um das Sykes-Picot-Abkommen. Er hielt fest, dass das Abkommen als eine Reaktion auf die Entwicklungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu deuten sei. Die französische Perspektive auf das 100-jährige Abkommen wurde schließlich durch den ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden der Europäischen Akademie für Geopolitik, Richard Rossin, dargestellt. Er führte aus, dass die beiden Diplomaten Sykes und Picot eine friedliche Lösung angestrebt hätten und die zionistische Idee auch im Interesse Frankreichs gelegen habe. Er beendete seine Ausführungen mit einer Warnung vor der Terrororganisation Islamischer Staat, die bestrebt sei, die Grenzen der Sykes-Picot Ordnung zu zerstören und ihren Machtbereich weiter auszudehnen.
Panel 2: Der Kollaps von Grenzen - Eine Zukunftsperspektive
Im zweiten Panel referierten Itamar Rabinovich, ehemaliger israelischer Botschafter in den Vereinigten Staaten und Professor an der Universität Tel Aviv, und Dr. Jacques Neriah (JCPA) über die Herausforderungen, die mit der damaligen Grenzziehung einhergingen. Sie wiesen darauf hin, dass drei der fünf Staaten, die aus dem Sykes-Picot Abkommen hervorgehen sollten, heute sogenannte „failed states“ sind und bezogen sich damit auf Syrien, den Irak und den Libanon. Nach seiner historischen Darstellung der Grenzverläufe ab 1916 stellte Prof. Rabinovich heraus, dass das Sykes-Picot-Abkommen nicht allein für das Scheitern einiger Staaten verantwortlich gemacht werden könne. Er nannte unter anderem den Konflikt zwischen den Sunniten und Schiiten als einen Grund für die Instabilität in der Region. Auf die Frage, was in der Zukunft passieren werde, antwortete er, dass die Wahlen in den USA 2017 einen wichtigen Meilenstein darstellen werden und auch die Rolle Russlands neudefiniert werden müsse. Dr. Neriah präsentierte seine Analysen über den internationalen Terrorismus und den „Terrorexport“ im Internet. Kritisch reflektierte er die Rolle Saudi Arabiens im Nahen Osten und den Einfluss des Königreiches auf Geldströme, Rohstoffe und Waffen. Jordanien lobte er als einen „Sicherheitsanker im Nahen Osten“.Panel 3: Rechte Aspekte und Internationales Recht Im Rahmen des dritten Panels wurden die rechtlichen Aspekte der Sykes-Picot-Ordnung, die noch heute Auswirkungen auf den Nahen Osten hat, beleuchtet. Zunächst sprach Das letzte Podium der Veranstaltung widmete sich unter der Moderation von Dr. Michael Borchard den strategischen Perspektiven auf das Sykes-Picot-Abkommens. Nach der thematischen Einführung durch Dr. Borchard gab
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die historischen, strategischen und geopolitischen Aspekte des Skyes-Picot-Abkommens, die auch 100 Jahre nach dessen Abschluss die Situation im Nahen Osten beeinflussen, von den Referenten umfassend und faktenbasiert dargestellt wurden, sodass der interessierten Zuhörerschaft ein Gesamtbild der Problematik eröffnet wurde. Dies war auch der umfassenden Expertise der internationalen Referenten aus verschiedenen Fachbereichen zu verdanken. Auch wenn die Frage, welche Rolle die Sykes-Picot-Ordnung in der Zukunft der Region noch spielen wird, nur hypothetisch angesprochen werden konnte, wurde der Anspruch des Veranstaltungstitels doch voll und ganz eingeholt, indem die „Lektionen“, die für eine heutige Politik gelernt werden können, eindeutig zur Sprache kamen: Eine größere Sensibilität für die ethnischen und religiösen Identitäten in der Region, die Rolle einer auf Frieden und Sicherheit gründenden Politik und die Verantwortung der westlichen Partner aus strategischer und geopolitischer Sicht.