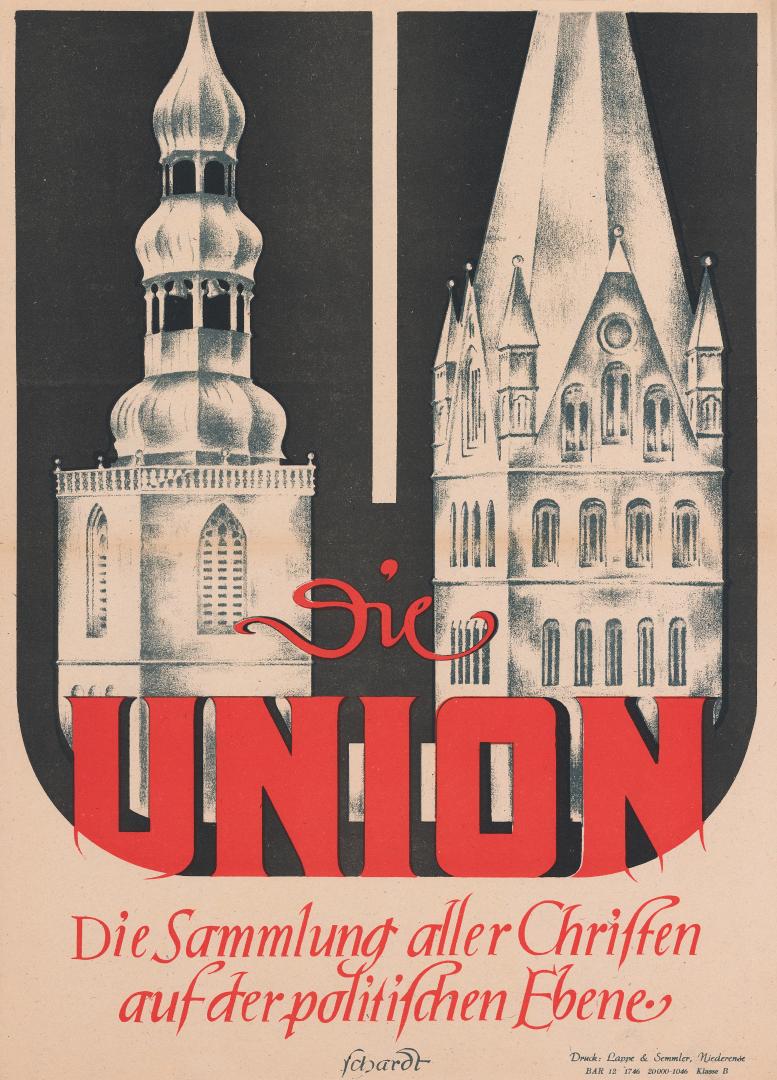Die Idee einer „christlichen Demokratie“ gehört nicht zu den traditionellen Denkbildern der europäischen politischen Theorie. Leben und Lehre Jesu Christi vollzogen sich bekanntlich in einer Umwelt, deren politischem Horizont der Rückgriff auf irgendwie „demokratisch“ geartete Überlieferungen vollkommen fremd geworden war. In den nachfolgenden Jahrhunderten einer christlich geprägten Welt- und Lebensordnung boten sich keinerlei ernst zu nehmende Ansatzpunkte für die Realisierung einer „demokratischen Christlichkeit“ – weder im staatlich-politischen Raum noch im Rahmen gesellschaftlicher oder kultureller Aktionsfelder. Und auch im innerkirchlichen Bereich waren entsprechende Entfaltungsräume denkbar gering, trotz der reformatorischen Aufbrüche im Zeitalter Luthers und Calvins. Politisches Handeln besaß zwar bis zum 18. Jahrhundert stets eine mehr oder weniger stark ausgeprägt christlich-konfessionelle Komponente, vollzog sich aber weitab von jedem „demokratischen“ Bezug. Verständnis und Bedeutung des Worts „Demokratie“ blieben weitgehend auf die Gelehrtensprache beschränkt, und selbst noch bei ausgesprochen „republikanisch“ argumentierenden Autoren wie Jean-Jacques Rousseau oder Immanuel Kant überwog zumeist eine eher negative Akzentuierung des Begriffs – fern aller semantischen Nähe zu christlichen Überlieferungssträngen. Einen betont christlich legitimierten Republikanismus gab es in den Jahrhunderten der Vormoderne allenfalls vereinzelt, etwa beim Aufstand der Niederlande gegen den Absolutismus der spanischen Habsburger im 16. Jahrhundert oder aufseiten radikaler puritanischer Sekten und Parteiungen in ihrer Auseinandersetzung mit den Herrschaftsansprüchen des Stuart-Absolutismus während des 17. Jahrhunderts.
Das änderte sich im Verlauf der 1780er-Jahre – nicht zuletzt durch die Vorboten, Verlaufsprozesse und Folgewirkungen der Französischen Revolution. Nun erst wurde „Demokratie“ im politischen Sprachgebrauch zu einem fester verankerten Ausdruck für mögliche Gestaltungsformen staatlicher Verfassungseinrichtungen.[1] Zugleich jedoch vollzog sich – im zeitweiligen Triumph der „totalitären Demokratie“ jakobinischer Prägung,[2] – eine erste nachhaltige Loslösung des neuen, radikal-demokratischen Staats von allen christlichen Traditionen, indem die angemaßte Allmacht der nunmehr republikanisch-revolutionären Ordnung einen unbedingten Herrschaftsanspruch über die Glaubens- und Gewissensentscheidungen der Bürger erhob. Die damit einsetzende Entfremdung zwischen Kirche und Staat, die wachsende Konfrontation tradierter christlicher Lebenswelten mit dem revolutionär-liberalen Zeitgeist sollte, ausgehend von der maßstabsetzenden Entwicklung in Frankreich,[3] eine Annäherung der beiden weltanschaulichen Lager, ein Zusammendenken von Christentum und Demokratie, zunächst nur sehr zögerlich in Gang kommen lassen. Katholische Autoren mit traditionalistischer Ausrichtung wie Joseph de Maistre[4] oder Louis-Gabriel de Bonald[5] verfochten im Zeitalter der Restauration – im Interesse religiös-kirchlicher Selbstbehauptung – eine betont theokratische Staats- und Gesellschaftskonzeption, deren innere Logik nicht dem autonomen Willen des Individuums oder den Gesetzen der souveränen menschlichen Vernunft folgte, sondern allein dem „Rhythmus der Trinität“[6] verpflichtet sein sollte. Von solchen Auffassungen führte keine Brücke zum Gedanken einer christlichen Demokratie moderner Prägung.
Begründung einer „Démocratie chrétienne“ in Frankreich
Diesen Weg ebnete als einer der Ersten der französische Theologe und Publizist Hugues Félicité Robert de Lamennais (1782–1854). Mit der 1834 erschienenen Programmschrift Paroles d’un croyant wurde er – nach Abkehr von zunächst verfochtenen traditionalistischen Ausgangspositionen – zum Begründer des Gedankens einer „Démocratie chrétienne“. Seit dieser Schrift empfahl sich Lamennais als Anreger und Impulsgeber für eine Erneuerung der Gesellschaft durch eine erneuerte christliche Religiosität, die, nunmehr im Bündnis von Kirche und Demokratie, einer Versöhnung christlichen und demokratisch-revolutionären Geistes das Wort redete.[7] Schon zuvor, in der von 1830 bis 1831 von ihm herausgegebenen Zeitung L’Avenir, hatte Lamennais für eine gänzliche Trennung von Staat und Kirche plädiert. Der Kirche sollten Freiheit und Unabhängigkeit vom Staat garantiert werden, der Staat wiederum sollte die Einhaltung der Gewissens-, Unterrichts-, Presse- und Vereinsfreiheit gewährleisten. Politische Neutralität der Kirche und Selbstbestimmung der politisch mündigen Bürgerschaft galten hier als sich wechselseitig bedingende und einander ergänzende Bausteine für die Formierung einer „politischen Christlichkeit“ im Jahrhundert der Revolutionen.[8]
Bei Lamennais verband sich die Forderung nach einer Trennung von Kirche und Staat zunehmend mit einer antimonarchischen Gesinnung. Die Krone erschien ihm, in eklatanter Verkennung der mit ihr tatsächlich verbundenen Entwicklungsmöglichkeiten, als prinzipielle Feindin jeder freiheitlich-demokratischen Ordnung[9] und als eine zur Anpassung an die sozialen Herausforderungen der Zeit unfähige Formation.[10] Zugleich überschätzte Lamennais die Möglichkeiten und Grenzen des der Kirche zugewiesenen gesellschaftlichen Auftrags – sie galt ihm als „Führerin“ der Völker auf dem Weg zur Demokratie. Für die mehrheitlich konservativ gesinnten Kreise des französischen Episkopats waren solche Einstellungen allemal inakzeptabel. Ihr Urheber geriet in wachsende Distanz zur Amtskirche und tendierte mehr und mehr zu einer auf die soziale Frage gerichteten Humanitätsreligion.[11] Das galt auch für die meisten anderen führenden Vertreter des liberalen Katholizismus, wie er sich im Frankreich der 1840er-Jahre, neben und nach Lamennais, in dessen Mitstreitern Jean Baptiste Henri Lacordaire (1802–1861), Philippe Buchez (1796–1865) und Antoine Frédéric Ozanam (1813–1853) verkörperte und im Revolutionsjahr 1848/49 in der Zeitschrift Ère Nouvelle, dem „zweite[n] große[n] Presseunternehmen der französischen Democratie chrétienne“[12], seinen Ausdruck finden sollte. Freilich wurde bereits hier, bei aller Hervorhebung der unbestreitbaren Herrschaftsrechte des Volks, nicht etwa einer wohlfeil eudämonistischen Doktrin vom Glück der vielen als höchstem Staatszweck das Wort geredet, sondern das Prinzip der Bürgertugend, der bürgerschaftlichen Verantwortung und zivilgesellschaftlichen Verpflichtung betont.
Aufs Ganze gesehen, waren die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit von Katholizismus und Demokratie, die sich unter der viel zitierten Devise „Dieu et la liberté“ mit alledem eröffnet hatten,[13] eng begrenzt – zumal sich die laizistische Dritte Französische Republik nach 1870 in einer jahrzehntelang dogmatisch verfochtenen Gegnerschaft zur katholischen Kirche gefiel. Der Versuch Papst Leos XIII., Christentum und Demokratie im Anschluss an die 1891 veröffentlichte Enzyklika Rerum Novarum miteinander zu versöhnen, blieb eine Episode und wurde bereits 1901 durch die Enzyklika Graves de communi „auf ein exklusiv sozialpolitisches Programm“[14] reduziert. Die in Frankreich erstmals vorgetragenen christlich-demokratischen Lehren vermochten sich in der politischen Praxis vorerst nicht durchzusetzen, „in der Folgezeit gingen Kirche und Demokratie getrennte Wege“[15] – trotz erheblicher Strahlkräfte, die damit verbundene Auffassungen in anderen europäischen Ländern entfalteten.[16]
Katholische Vereins- und Parteigründungen in Deutschland
Im deutschen Geschehensraum entwickelte sich der Gedanke einer christlichen Demokratie zunächst gleichfalls vor allem als Reaktion auf die von der Französischen Revolution und deren Folgen ausgehenden Entkirchlichungstendenzen. Die Forderung nach Freiheit der Kirche von staatlicher Bevormundung verband sich mit dem Wunsch, den sich zusehends säkularisierenden Staat mit den Prinzipien eines erneuerten Glaubenslebens zu versöhnen, ihn „nicht nur von außen her zu begrenzen, sondern von innen zu durchdringen“.[17] Zur eingeforderten Freiheit der Kirche im Staat gehörte selbstverständlich auch die Freiheit publizistischer Betätigung und christlicher Vereinsgründungen. Katholisch-konservative Publizisten wie Joseph Görres (1776–1848) und dessen Münchner Kreis um die Zeitschrift Historisch-politische Blätter hatten solchen Forderungen in den Jahren des Vormärz zusehends Gehör verschafft und dabei bereits erste Brücken zu den politischen Vorstellungen des bürgerlichen Liberalismus und Konstitutionalismus mit seinem Ideal einer Repräsentativverfassung auf parlamentarischer Grundlage geschlagen.[18]
Dem deutschen Katholizismus gelang, wesentlich befördert durch die Aktivitäten seiner politischen Vertretung, der 1870/71 gegründeten Zentrumspartei, nach Abbau der Kulturkampfgesetze seit Ende der 1870er-Jahre, die allmähliche Integration in den preußisch-protestantisch dominierten kleindeutschen Nationalstaat – nicht zuletzt durch Mitwirkung am Zustandekommen zahlreicher Reichsgesetze. Eine programmatisch ausgeprägte „demokratische Christlichkeit“ war damit freilich nicht unbedingt verbunden, zumal die Partei bis zur Jahrhundertwende ein weitgehend konservativ-aristokratisches Gepräge trug, das weniger in deren Reichstagsfraktion, weitaus stärker jedoch in ihren zahlreichen Vorfeldorganisationen zum Ausdruck kam. Seit den 1864 von Papst Pius IX. im Syllabus errorum vorgetragenen anti-modernistischen Positionen, mit ihrer expliziten Frontstellung gegen den liberalen Freiheitsgedanken und ihrem Beharren auf der Trias von Autorität, Hierarchie und Ordnung als verbindlichen Orientierungsgrößen für jeden gläubigen Katholiken, gerieten alternative politische Handlungsoptionen nur allzu leicht in den Verdacht, die zunächst weithin vorherrschende ultramontan-integrationalistische Kirchlichkeit zu untergraben.[19] Zwar boten mancherlei Formen der „Selbstorganisation des Katholismus“[20] zunehmend Möglichkeiten für die Entfaltung demokratisch-emanzipatorischer Laienaktivitäten – allen voran der 1890 gegründete „Volksverein für das Katholische Deutschland“, der 1914 mit fast 800.000 eingeschriebenen Mitgliedern neben und nach der Sozialdemokratie immerhin als die erfolgreichste deutsche Massenorganisation firmierte,[21] oder die Vertreter jenes „Reformkatholizismus“, die sich im Umfeld der 1903 von Carl Muth (1867–1944) gegründeten Zeitschrift Hochland versammelten.[22] Eine „Versöhnung von Katholizismus und Moderne“[23] vermochten solche Bestrebungen jedoch nur bedingt einzuleiten. Das galt auch mit Blick auf die parteipolitische Vertretung der deutschen Katholiken im Kaiserreich, in deren Reihen eine seit 1903 betont christlich-„demokratisch“ agierende, von „den Kräften des agrarischen und kleingewerblichen Populismus“[24] getragene Bewegung um den Volksschullehrer und Publizisten Matthias Erzberger (1875–1921) gegenüber konservativ-„etatistischen“ Stimmen einen schweren Stand hatte.
Politische Organisationen der evangelischen Christen
Vergleichbares galt für das freilich weitaus weniger wirkungsmächtige evangelische Pendant zum Zentrum, die 1878 durch den Berliner Hof- und Domprediger Adolf Stoecker gegründete Christlich-Soziale Arbeiterpartei (seit 1881 Christlich-Soziale Partei, nunmehr mit antisemitischer Orientierung), die mittels Forcierung sozialpolitischer Maßnahmen die prekäre Lage der Arbeiterschaft zu verbessern suchte und dem gefürchteten Schreckbild einer sozialen Revolution durch eine Wiederverchristlichung des Vierten Standes entgegenwirken wollte.[25] Derartige Bestrebungen, die den Staat auf seine soziale Verantwortung verpflichteten, entsprachen der traditionell starken Bindung der evangelisch-lutherischen Kirche an die monarchische Obrigkeit, die als überparteiliche Sachwalterin evangelischer Interessen galt. Das Ethos des Gehorsams gegenüber einer derart legitimierten staatlichen Autorität, bei gleichzeitiger Betonung der persönlichen Gewissensfreiheit des Einzelnen, ließ wenig Raum für die Entfaltung bürgerschaftlicher Emanzipationsmodelle. Der 1887 gegründete Evangelische Bund zur Wahrung der deutsch-protestantischen Interessen verfocht als eine der größten Massenorganisationen des Kaiserreichs mit (1914) immerhin 510.000 Mitgliedern strikt nationalistische und antikatholische Positionen, weit entfernt von interkonfessionellen oder gar christlich-demokratischen Überlegungen.
So blieb der Gedanke einer christlichen Demokratie im kaiserlichen Deutschland unausgefaltet. Dass er aber ansatzweise bereits damals artikuliert worden ist, lehrt ein Blick auf die Aktivitäten des Evangelisch-Sozialen Kongresses. Dieser 1890 ins Leben gerufene Verein fokussierte in seinen publizistischen Bekundungen und propagandistischen Aktivitäten auf soziale Missstände und Probleme und entwickelte sich unter dem Einfluss des national-liberalen Politikers und Theologen Friedrich Naumann (1860–1919) zusehends zu einem Diskussionsforum bürgerlich-demokratischer Sozialreformer[26] – wie ja ohnehin die soziale Bewegung des fortgeschrittenen 19. Jahrhunderts mit ihrer Forderung nach einer umfassenden Erneuerung der Gesellschaft die Heraufkunft der christlichen Demokratie von Anfang an begleitet hat. Und auf katholischer Seite vertraten die 1899 zusammengeschlossenen christlichen Gewerkschaften (seit 1901: Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften Deutschlands) unter ihrem langjährigen Generalsekretär Adam Stegerwald (1874–1945) erste zaghafte Ansätze jener Prinzipien, die ein halbes Jahrhundert später den Charakter der christlichen Demokratie auszeichnen sollten:[27] Begrenzung der Staatsmacht zugunsten bürgerschaftlicher Selbstorganisation, das Ideal eines am Gemeinwohl ausgerichteten klassenübergreifenden Interessenausgleichs, Mitbestimmung der Arbeitnehmer und Sozialpartnerschaft, Wohlfahrtsfürsorge und Erziehung zu sozialer Verantwortung und Solidarität, Gleichberechtigung und Interkonfessionalität. Die bereits 1890 zu einem „Gesamtverband“ vereinigten Evangelischen Arbeitervereine vertraten demgegenüber mit (1914) etwa 150.000 Mitgliedern eine entschieden antikatholische Richtung.
Christliche Parteien in Europa
Im Übrigen entstanden in den Jahrzehnten vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs auch in anderen kontinentaleuropäischen Ländern christlich-konfessionell gebundene Parteien – so in Belgien 1869 (Katholieke Partij), in der Schweiz 1882 (Katholisch-konservative Partei) und in den Niederlanden 1879 (Anti-Revolutionaire Partij) beziehungsweise 1908 (Christelijk-Historische Unie). Das Bemühen um eine Artikulation christlicher Wertvorgaben und Normsetzungen angesichts des rapide voranschreitenden Prozesses der Fundamentaldemokratisierung stand mithin von Anfang an in gesamteuropäischen Zusammenhängen,[28] die sich später, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Etablierung großer christlicher Parteien vor allem in Deutschland, Frankreich und Italien, erneut manifestierten und in entsprechenden Organisationen ihren Niederschlag finden sollten – allen voran in der 1947 ins Leben getretenen Nouvelles Équipes Internationales (NEI) und ihrer 1965 gegründeten Nachfolgerin, der Europäischen Union Christlicher Demokraten (EUCD). Beiden Einrichtungen ging es um die Zusammenarbeit christlicher Parteien in Europa und um die Formulierung gemeinsamer politischer Programmpunkte im Interesse verstärkter europäischer Gemeinschaftsbildung und Integration.[29] Jedenfalls ist in diesem Zusammenhang mit Recht darauf hingewiesen worden, dass „das Beharren auf gewissen vorstaatlichen, natürlichen Rechten, die aus einer bestimmten Interpretation der Gesellschaft abgeleitet wurden“,[30] nicht nur zu den von Anfang an prägenden Leitmaßstäben christlich-demokratischer Politik zählte, sondern eben auch die Grundlage für eine grenzüberschreitende Kooperation entsprechend orientierter politischer Parteien in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bilden sollte.
Weimarer Republik
Es war durchaus kein Zufall, dass sich nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs im November 1918 zunächst vor allem in Kreisen der christlichen Arbeitnehmerschaft jene Stimmen und Wünsche vermehrt artikulierten, die den engen Grenzen einer konfessionell gebundenen Milieupartei, wie sie dem Zentrum bisher gesetzt waren, durch Etablierung einer „christlichen“ und „demokratischen“ Formation zu entgehen versuchten. Der maßgeblich von Adam Stegerwald an der Jahreswende 1919/20 betriebene Versuch, den Parteinamen des Zentrums in diesem Sinne mit dem Zusatz „Christlich-demokratische Volkspartei“ zu versehen, blieb allerdings ebenso erfolglos wie die kurzzeitig verstärkt betriebene Einbindung nichtkatholischer Persönlichkeiten in die politisch-administrativen Organisationsstrukturen der Partei.[31]
Das bekenntnistreue protestantische Wählervolk fand seine politische Heimat nach 1918 stattdessen überwiegend in der Deutschnationalen Volkspartei, die zahlreiche prominente Mitglieder der evangelischen Amtskirche – wie beispielsweise Otto Dibelius (1880–1967), den Generalsuperintendenten der Kurmark, späteren Bischof und Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland – zu ihren Anhängern zählte, doch auch von nicht weniger prominenten konservativen Rechtskatholiken – allen voran von Martin Spahn (1875–1945), Neuzeithistoriker an der Kölner Universität und zuletzt NSDAP-Reichstagsabgeordneter – unterstützt wurde.[32] Die traditionell starke Bindung der evangelisch-lutherischen Kirche an die monarchische Obrigkeit, die als überparteiliche Sachverwalterin evangelischer Interessen galt, hatte ein spezifisch ausgeprägtes Gehorsamsethos gegenüber staatlichen Autoritäten auch nach dem Umbruch von 1918 vorherrschen lassen und bot – bei aller Betonung der persönlichen Gewissensfreiheit des Einzelnen – wenig Raum für die Entfaltung bürgerschaftlicher Emanzipationsmodelle oder christlich-demokratischer Entwicklungsperspektiven. Spezielle evangelisch-konfessionelle Parteigruppierungen entstanden erst in den Krisenjahren der Weimarer Republik, so die Christlich-Nationale Bauern- und Landvolkpartei 1928 und der Christlich-Soziale Volksdienst 1929. Erstere galt als Interessenvertretung der kleinen und mittleren Bauernschaft in Schleswig-Holstein und im fränkischen Raum,[33] Letztere firmierte als politische Organisation des deutschen Pietismus, mit einem stark sozialreformerischen Einschlag.[34] Zur dezidierten Verfechterin des Gedankens einer christlichen Demokratie ist keine dieser beiden Parteien geworden.
Entwicklung des Zentrums seit 1918
Und auch für das Zentrum galt dies in den Jahren der Weimarer Republik nur sehr eingeschränkt. Zwar gelang führenden Vertretern der Partei eine erstaunlich rasche Hinwendung zur parlamentarisch-demokratischen Ordnung von 1919, unter ausdrücklicher Anerkennung der ihr zugrundeliegenden Prinzipien der Volkssouveränität, der freiheitsverbürgenden Grundrechte und der das „Gemeinwohl“ in den Mittelpunkt stellenden Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung. Insofern konnten nun eigentlich all jene Hürden als überwunden gelten, die der vollständigen Realisierung des Gedankens einer christlichen Demokratie bisher, im kaiserlichen Deutschland vor 1914, noch entgegengestanden hatten. Das Zentrum hat sich in diesem Sinne durch sein parteipolitisches Wirken aktiv in den neuen republikanischen Staat eingebracht und sich seit Beginn der 1920er-Jahre in zahlreichen öffentlichen Verlautbarungen zugleich dazu bekannt, Staat und Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur stärker mit den Grundsätzen des Christentums in Einklang zu bringen. Das hieß damals, nach dem katastrophalen Ausgang des Ersten Weltkriegs und den Verwerfungen der unmittelbaren Nachkriegszeit, erneut einer sozial verantworteten Politik das Wort zu reden, die bewusst auf Solidarität mit den Minderbemittelten setzte, um so den weithin verloren gegangenen gesellschaftlichen Zusammenhalt wiederzugewinnen.
Doch eine christliche Demokratie im vollen Wortsinn konnte aus solchen Ansätzen seinerzeit nicht erwachsen – und das hatte mehrere Gründe. Zum einen war ganz offensichtlich, dass sich die Partei keineswegs geschlossen als eine unbedingt „republikanische“ Formation verstand – bei vielen ihrer Wähler und Mitglieder blieb ein entsprechend ausgeprägtes „demokratisches“ Selbstverständnis äußerst gering.[35] Zum anderen verführte der für das Zentrum charakteristische Mangel an Herausbildung einer programmatischen Eigenständigkeit „im Sinne der Schaffung eines dezidiert christlichen wirtschafts- und sozialpolitischen Modells“[36] die Partei in der Spätphase der Weimarer Republik zu einer erhöhten Nachgiebigkeit gegenüber autoritären Problemlösungskonzeptionen („autoritäre Demokratie“), die den Zeitgeist ebenso widerspiegelten, wie sie dem Gedanken einer christlichen Demokratie widersprachen.[37] Und schließlich begegnete die 1920 etablierte süddeutsche Sonderformation des Zentrums, die strikt föderalistisch und landespatriotisch gesinnte Bayerische Volkspartei, der republikanischen Reichsverfassung von Anfang an mit Skepsis und Distanz.[38]
Dass die Zentrumspartei (als einzige) zwischen 1919 und 1932 an allen Koalitionsregierungen des Reichs beteiligt war und in neun (von zwanzig) Kabinetten vier (von neun) Reichskanzler stellte, dass die Partei darüber hinaus in zahlreichen Reichsländern, allen voran in Preußen, Hessen und Baden, in der Regierungsmitverantwortung stand, sollte ihre Mandatsträger im Reichstag zuletzt fatalerweise freilich nicht davon abhalten, in einer präzedenzlosen „historische[n] Fehlentscheidung“[39] Ende März 1933 für die Annahme des von den Nationalsozialisten eingebrachten „Ermächtigungsgesetzes“ („Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“) zu votieren, dessen Bestimmungen die Gewaltenteilung und die Verantwortlichkeit der Reichsregierung gegenüber der parlamentarischen Vertretung der Nation beseitigten. Die beiden noch im Reichstag verbliebenen, auf ein Minimum geschrumpften evangelischen Gruppierungen – Christlich-sozialer Volksdienst und Deutschnationale Volkspartei – taten es dem Zentrum gleich. So trugen die berufenen Repräsentanten einer vermeintlich „christlichen“ Politik unterschiedslos dazu bei, dass hinfort allen christlich-demokratischen Handlungsoptionen in Deutschland für lange Zeit jeglicher Boden entzogen wurde.
Aufstieg der christlichen Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg
Die Erfahrung der totalitären Tyrannei des Nationalsozialismus, die in Verfolgung und Völkermord, Kriegsniederlage und geistig-materiellem Zusammenbruch mündete, darf mit einigem Recht als der maßgebliche Impuls gelten, dem die christliche Demokratie in den Jahren nach 1945 ihren raschen Aufstieg verdankte – in Westdeutschland ebenso wie in Italien und Frankreich. Im Widerstand gegen das nationalsozialistische Unrechtsregime hatten sich katholische und evangelische Christen, christliche Gewerkschafter und Zentrumspolitiker mit zahlreichen anderen Vertretern aus den unterschiedlichsten politischen Lagern zusammengefunden.[40] Und sie waren sich zumeist darin einig gewesen, dass dem erhofften und erstrebten Ende des „Dritten Reichs“ ein Neuaufbau von Staat und Gesellschaft auf der Grundlage demokratischer und christlicher Werte folgen sollte. Christliche Demokratie, bisher ein im deutschen politischen Diskurs selten gebräuchlicher und unbestimmt verwendeter Begriff, wurde nun nicht nur mit festen Inhalten gefüllt, sondern auch zum Markenzeichen jener Partei, die als interkonfessionelle Sammlungsbewegung allen sozialen Schichten offenstehen und sich hinfort für zwei Jahrzehnte zur dominierenden Kraft im politischen Leben der Bundesrepublik Deutschland entwickeln sollte.
Es war bezeichnend für die parteipolitische Formierung einer christlichen Demokratie in den Jahren nach 1945, dass die parallel verlaufende Entfaltung ihrer weltanschaulichen Programmatik nicht in Form einer kohärenten, fest umschriebenen Theoriebildung erfolgte, sondern sich eher als okkasionelle Positionsbestimmung vollzog – orientiert an den konkreten Herausforderungen des Alltagslebens, die es in einer kriegszerstörten und vielfach demontierten Gegenwart zunächst mit gebotener Nüchternheit zu bewältigen galt.[41] Eine eher gering ausgeprägte Prinzipiengebundenheit politischen Handelns hatte vielen Vertretern einer betont „christlichen“ Politik bereits in den Jahren der Weimarer Republik entsprochen, und generell ist in diesen Zusammenhängen mehrfach darauf verwiesen worden, „daß politische Programme für sie (das heißt die Repräsentanten einer christlichen Demokratie) immer nur Standortbestimmungen im jeweiligen Augenblick sein können und sich daher auch mit den jeweils wechselnden geschichtlichen Lagen wieder wandeln“.[42] Zudem hätte eine allzu starke Fixierung auf weltanschauliche Grundsatzpositionen dem erklärten Ziel der meisten nach 1945 um einen parteipolitischen Neuanfang bemühten christlichen Demokaten widersprochen. Dieses Ziel hieß: Schaffung einer großen christlichen Volkspartei auf interkonfessioneller Basis, die allen Bevölkerungsschichten offenstehen sollte.
Die allgemein verbindlichen Kriterien für den Erfolg einer solchen „Volkspartei“ hatte der 1933 emigrierte Staatsrechtslehrer Otto Kirchheimer (1905–1965), nun schon mit Blick auf die etablierte Parteienlandschaft der Bundesrepublik Deutschland, in einer seiner letzten zu Lebzeiten erschienenen Veröffentlichungen namhaft gemacht.[43] Kirchheimers Kriterien für eine von ihm so genannte „Catch-all-Party“ beziehungsweise „Sammlungspartei“[44] waren und sind bis heute maßgeblich: Im Interesse maximalen Stimmengewinns und eindeutiger Wahlerfolge sei jede moderne „Volkspartei“ nicht nur auf weltanschaulichen Pluralismus und auf ein hohes Maß an innerparteilicher Toleranz zu verpflichten; die ihr stets gebotene Orientierung am Wählerwillen nötige sie darüber hinaus zur situationsbedingten Anpassung an jeweils vorherrschende Mehrheitsmeinungen und weise der Formulierung ideologisch konsistenter Programme und Grundsatzbekundungen einen deutlich nachgeordneten Stellenwert zu. Für einen „christlichen“ Politiker verstand und versteht sich eine derart wandlungsaffine Einstellung beinahe von selbst. Ihm kommt es nicht darauf an, starr gehandhabte religiöse Dogmen zu verkünden, sondern der Selbstbehauptung des Christen in jeder historischen Situation zu dienen, christliches Leben in jedem geschichtlichen Augenblick zu verwirklichen.[45]
Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine gekürzte Version von Frank-Lothar Kroll: Christliche Demokratie – vom Glaubensbekenntnis zum politischen Programm? in: Norbert Lammert (Hg.): Christlich Demokratische Union. Beiträge und Positionen zur Geschichte der CDU. München 2020, S. 361–396. Die Online-Publikation erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Siedler-Verlags.
Anmerkungen:
[1] Zur Wortgeschichte im vorliegenden Zusammenhang noch immer knapp und erhellend Hans Maier: Demokratie, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie 2, 1972, Sp. 50–55; Ders.: Demokratie, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland 1, 1972, S. 839–848, 854–873; vgl. ferner Ders.: Kirche und Demokratie, in: Zeitschrift für Politik 10 (1963), S. 329–345; Ders.: Herkunft und Grundlagen der christlichen Demokratie, in: Heinz Hürten (Hg.): Christliche Parteien in Europa. Osnabrück 1964, S. 11–44; zum Grundsätzlichen Ders.: Kirche – Demokratie. Weg und Ziel einer spannungsreichen Partnerschaft. Freiburg i. Br./Basel/Wien 1979; zur ideengeschichtlichen Verortung sehr kenntnisreich Rudolf Uertz: Die Christliche Demokratie im politischen Ideenspektrum, in: Historisch-politische Mitteilungen 9 (2002), S. 31–62; Ders.: Zur Theorie und Programmatik der Christlichen Demokratie, in: Günter Buchstab/Rudolf Uertz (Hg.): Christliche Demokratie im zusammenwachsenden Europa. Entwicklungen, Programmatik, Perspektiven. Freiburg i. Br. 2004, S. 32–63.
[2] Vgl. unübertroffen Jakov Leib Talmon: Die Ursprünge der totalitären Demokratie. Köln/Opladen 1961, S. 110–119.
[3] Dazu die klassische Analyse von Waldemar Gurian: Die politischen und sozialen Ideen des französischen Katholizismus 1789/1914. Mönchengladbach 1929, bes. S. 57 ff.
[4] Vgl. weiterhin unentbehrlich Peter Richard Rohden: Joseph de Maistre als politischer Theoretiker. München 1929.
[5] Dazu Robert Spaemann: Der Ursprung der Soziologie aus dem Geist der Restauration. Studien über L. G. A. de Bonald. München 1959, bes. S. 119 ff.
[6] So treffend Hans Maier: Revolution und Kirche. Studien zur Frühgeschichte der christlichen Demokratie (1789–1901). 2., erweiterte Auflage. Freiburg i. Br. 1965, S. 160.
[7] Zum Folgenden weiterhin grundlegend Maier: Revolution und Kirche, S. 181 ff., 190 ff.; über Lamennais zuletzt im Zusammenhang Julian Strube: Sozialismus, Katholizismus und Okkultismus im Frankreich des 19. Jahrhunderts. Berlin/Boston 2016, S. 177–211.
[8] Dazu erhellend Hans Barth: Die Staats- und Gesellschaftsphilosophie von Félicité de Lamennais (1948), wiederabgedruckt in: Ders.: Die Idee der Ordnung. Beiträge zu einer politischen Philosophie. Erlenbach-Zürich/Stuttgart 1958, S. 96–131.
[9] Zur überfälligen Richtigstellung dieses Fehlurteils vgl. prinzipiell Frank-Lothar Kroll: Monarchische Modernisierung. Überlegungen zum Verhältnis von Königsherrschaft und Elitenanpassung im Europa des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, in: Ders./Martin Munke (Hg.): Hannover – Coburg-Gotha – Windsor. Probleme und Perspektiven einer vergleichenden deutsch-britischen Dynastiegeschichte vom 18. bis in das 20. Jahrhundert/Problems and perspectives of a comparative German-British dynastic history from the 18th to the 20th century. Berlin 2015, S. 201–242.
[10] Zur Korrektur dieses weitverbreiteten Missverständnisses vgl. auch hier jetzt Frank-Lothar Kroll: Die Idee eines sozialen Königtums im 19. Jahrhundert, in: Ders./Dieter J. Weiß (Hg.): Inszenierung oder Legitimatimation?/Monarchy and the Art of Representation. Die Monarchie in Europa im 19. und 20. Jahrhundert. Ein deutsch-englischer Vergleich. Berlin 2015, S. 111–140; zu Frankreich speziell S. 130–134.
[11] Zu diesem Aspekt speziell Hans Maier: Politischer Katholizismus, sozialer Katholizismus, christliche Demokratie, in: Civitas. Jahrbuch für christliche Gesellschaftsordnung. 1962, S. 9–27; sowie prinzipiell Rudolf Uertz: Christliche Sozialethik und Christliche Demokratie. Zur Zukunftsfähigkeit des sozialethischen Dialogs, in: Historisch-politische Mitteilungen 8 (2001), S. 267–290, mit weiterführender Literatur.
[12] Maier: Revolution und Kirche, S. 220.
[13] Dazu explizit Waldemar Gurian: Lamennais, in: Perspektiven 3 (1953), S. 69–85.
[14] So treffend Rudolf Uertz: Die Christliche Demokratie in der historischen und sozialwissenschaftlichen Forschung. Eine Problemskizze, in: Historisch-Politische Mitteilungen 2 (1995), S. 1–24, hier S. 15. Dort (S. 5 ff.) auch ein vorzüglicher Überblick zum Forschungsstand.
[15] Maier: Revolution und Kirche, S. 275.
[16] Vgl. z. B. Kurt Jürgensen: Lamennais und die Gestaltung des belgischen Staates. Der liberale Katholizismus in der Verfassungsbewegung des 19. Jahrhunderts. Wiesbaden 1963; William Gordon Roe: Lamennais and England. The Reception of Lamennais’s Religious Ideas in England in the Nineteenth Century. Oxford 1966; Gerhard Valerius: Deutscher Katholizismus und Lamennais. Die Auseinandersetzung in der katholischen Publizistik 1817–1854. Mainz 1983.
[17] So Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band II: Der Kampf um Einheit und Freiheit 1830 bis 1850. Zweite, verbesserte Auflage. Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1975, S. 350. Die vor allem in Preußen unter Friedrich Wilhelm IV. von evangelischen Konservativen – allen voran Ernst Ludwig von Gerlach und Friedrich Julius Stahl – verfochtene Idee eines „Christlichen Staates“ stand in anderen geistig-politischen Zusammenhängen und bleibt daher hier außer Betracht; vgl. dazu die knappe Skizze von Hans-Joachim Schoeps: Der Christliche Staat im Zeitalter der Restauration (1966), wiederabgedruckt in: Ders.: Ein weites Feld. Gesammelte Aufsätze. Berlin 1980, S. 309–324. Vergleichbares gilt mit Blick auf Otto von Bismarck, der gegenüber einer prononciert „christlichen Politik“ sein staatsmännisches Handeln als ein allein seinem Gewissen verpflichteter „christlicher Politiker“ betonte; dazu Frank-Lothar Kroll: Der intellektuelle Bismarck, in: Ders.: Das geistige Preußen. Zur Ideengeschichte eines Staates. Paderborn/München/Wien/Zürich 2001, S. 169–182, bes. S. 175 ff.
[18] Dazu im vorliegenden Zusammenhang als Überblick Winfried Becker: Der lange Anlauf zur Christlichen Demokratie. Joseph Görres und andere Interpreten im 19. Jahrhundert, in: Ders./Rudolf Morsey (Hg.): Christliche Demokratie in Europa. Grundlagen und Entwicklungen seit dem 19. Jahrhundert. Köln/Wien 1988, S. 1–27, bes. S. 8 ff.
[19] Zum Problem noch immer anregend weiterhin Karl Buchheim: Ultramontanismus und Demokratie. Der Weg der deutschen Katholiken im 19. Jahrhundert. München 1963, bes. S. 131 ff.
[20] So Thomas Nipperdey: Religion im Umbruch. Deutschland 1870–1918. München 1988, S. 45.
[21] Vgl. Gotthard Klein: Der Volksverein für das katholische Deutschland 1890–1933. Geschichte, Bedeutung, Untergang. Paderborn/München/Wien/Zürich 1996, bes. S. 67 ff.
[22] Vgl. Felix Dirsch: Das „Hochland“ – Eine katholisch-konservative Zeitschrift zwischen Literatur und Politik 1903–1941, in: Hans-Christof Kraus (Hg.): Konservative Zeitschriften zwischen Kaiserreich und Diktatur. Fünf Fallstudien. Berlin 2003, S. 45–96.
[23] Nipperdey: Religion in Umbruch, S. 38; zur Entstehung des katholischen Milieus im ambivalenten Spannungsfeld von Modernismus und Antimodernismus vgl. speziell Urs Altermatt: Katholizismus – Antimodernismus mit modernen Mitteln, in: Ders./Peter Schulz (Hg.): Moderne als Problem des Katholizismus. Regensburg 1995, S. 33–50.
[24] So Wilfried Loth: Katholiken im Kaiserreich. Der politische Katholizismus in der Krise des wilhelminischen Deutschlands. Düsseldorf 1984, S. 94.
[25] Vgl. als Überblick weiterhin instruktiv Erkki J. Kouri: Der deutsche Protestantismus und die Soziale Frage 1870–1919. Zur Sozialpolitik im Bildungsbürgertum. Berlin/New York 1984, bes. S. 92 ff.
[26] Dazu monografisch Gottfried Kretschmar: Der Evangelisch-Soziale Kongress. Der deutsche Protestantismus und die soziale Frage. Stuttgart 1972, bes. S. 30 ff., 57 ff.
[27] Zu ihrer Programmatik vgl. das voluminöse Werk von Michael Schneider: Die christlichen Gewerkschaften 1894–1933. Bonn 1982, S. 253 ff.
[28] Vgl. eingehend die Chronologie von Hans August Lücker und Karl Josef Hahn: Christliche Demokraten bauen Europa. Mit einem Geleitwort von Leo Tindemans. Bonn 1987.
[29] Dazu direkt Wolfram Kaiser: Deutschland exkulpieren und Europa aufbauen. Parteienkooperation der europäischen Christdemokraten in den Nouvelles Equipes Internationales 1947–1965, in: Michael Gehler/Wolfram Kaiser/Helmut Wohnout (Hg.): Christdemokratie in Europa im 20. Jahrhundert. Wien/Köln/Weimar 2001, S. 695–719; vgl. ferner sehr instruktiv Michael Gehler: Begegnungsort des Kalten Krieges. Der „Genfer Kreis“ und die geheimen Absprachen westeuropäischer Christdemokraten 1947–1955, in: ebd., S. 642–694; sowie Michael Gehler/Wolfram Kaiser: Transnationalism and Early European Integration: The Nouvelles Equipes Internationales and the Geneva Circle 1947–1957, in: The Historical Journal 44 (2001), S. 773–798.
[30] So Winfried Becker: Christliche Demokratie, in: Ders./Günter Buchstab/Anselm Doering-Manteuffel/Rudolf Morsey (Hg.): Lexikon der Christlichen Demokratie in Deutschland. Paderborn/München/Wien/Zürich 2002, S. 9–23, hier S. 13.
[31] Dazu speziell Günther Grünthal: „Zusammenschluß“ oder „Evangelisches Zentrum“? Ein Beitrag zur Geschichte der Deutschen Zentrumspartei in der Weimarer Republik (1979), wiederabgedruckt in: Ders.: Verfassung und Verfassungswandel. Ausgewählte Abhandlungen. Hg. von Frank-Lothar Kroll, Joachim Stemmler und Hendrik Thoss. Berlin 2003, S. 346–372.
[32] Zur evangelischen Ausrichtung der Deutschnationalen Volkspartei als Repräsentantin des „deutschen Nationalprotestantismus“ vgl. im vorliegenden Zusammenhang Maik Ohnezeit: Zwischen „schärfster Opposition“ und dem „Willen zur Macht“. Die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) in der Weimarer Republik 1918–1928. Düsseldorf 2011, S. 117–120, hier S. 119; zur politischen Haltung der protestantischen Kirchenführung in der Weimarer Republik allgemein Jonathan R. C. Wright: „Above Parties“. The Political Attitudes of the Germen Protestant Church Leadership 1918–1933. London 1974, bes. S. 49 ff.
[33] Dazu Markus Müller: Die Christlich-Nationale Bauern- und Landvolkpartei 1928–1933. Düsseldorf 2001.
[34] Dazu Günter Opitz: Der Christlich-soziale Volksdienst. Versuch einer protestantischen Partei in der Weimarer Republik. Düsseldorf 1969, bes. S. 315–325.
[35] Das betont z. B. Karsten Ruppert: Im Dienst am Staat von Weimar. Das Zentrum als regierende Partei in der Weimarer Republik 1923–1930. Düsseldorf 1992, bes. S. 195 ff., 227 ff., 409 f.
[36] So Jürgen Elvert: Gesellschaftlicher Mikrokosmos oder Mehrheitsbeschaffer im Reichstag? Das Zentrum 1918–1933, in: Gehler/Kaiser/Wohnout (Hg.): Christdemokratie in Europa im 20. Jahrhundert, S. 160–180, hier S. 173.
[37] Dazu noch immer ausgewogen Rudolf Morsey: Der Untergang des politischen Katholizismus. Die Zentrumspartei zwischen christlichem Selbstverständnis und „nationaler Erhebung“ 1932/33. Stuttgart/Zürich 1977, bes. 61 ff., 70 ff.
[38] Dazu weiterhin grundlegend Klaus Schönhoven: Die Bayerische Volkspartei 1924–1932. Düsseldorf 1972, bes. S. 35 ff., 42 ff., 172 ff.; sowie – als „Fortsetzung“ – Ders.: Zwischen Anpassung und Ausschaltung. Die Bayerische Volkspartei in der Endphase der Weimarer Republik 1932/33, in: Historische Zeitschrift 224 (1977), S. 340–378.
[39] Rudolf Morsey: 1918–1933, in: Becker/Buchstab/Doering-Manteuffel/Morsey (Hg.): Lexikon der Christlichen Demokratie, S. 35–43, hier S. 39.
[40] Vgl. zum Thema als knappen Überblick Winfried Becker: Politische Neuordnung aus der Erfahrung des Widerstands: Katholizismus und Union, in: Peter Steinbach (Hg.): Widerstand. Ein Problem zwischen Theorie und Geschichte. Köln 1987, S. 261–292; ferner die Biografiensammlung bei Günter Buchstab/Brigitte Kaff/Hans-Otto Kleinmann (Hg.): Christliche Demokraten gegen Hitler. Aus Verfolgung und Widerstand zur Union. Freiburg/Basel/Wien 2004.
[41] Das betont zu Recht Heinz Hürten: Der Beitrag Christlicher Demokraten zum geistigen und politischen Wiederaufbau und zur europäischen Integration nach 1945: Bundesrepublik Deutschland, in: Becker/Morsey (Hg.): Christliche Demokratie in Europa, S. 213–223.
[42] Maier: Revolution und Kirche, S. 21; vgl. dazu auch die allerdings äußerst oberflächlichen und daher wenig brauchbaren Ausführungen des britischen liberalen Politikers Michael P. Fogarty: Christliche Demokratie in Westeuropa 1820–1953. Basel/Freiburg/Wien 1959, S. 1–10.
[43] Otto Kirchheimer: Der Wandel des westeuropäischen Parteisystems, in: Politische Vierteljahresschrift 6 (1965), S. 20–41; vgl. Ders.: Parteistruktur und Massendemokratie in Europa. in: Archiv des öffentlichen Rechts 79 (1953/54), S. 301–325; Ders.: Der Weg zur Allerweltspartei, in: Kurt Lenk/Franz Neumann (Hg.): Theorie und Soziologie der politischen Parteien. Darmstadt/Neuwied 1974, Bd. 2, S. 113–138; zur Bedeutung von Kirchheimers Parteienlehre maßgeblich Alfons Söllner: Politische Dialektik der Aufklärung – zum Nachkriegswerk von Franz Neumann und Otto Kirchheimer (1982), wiederabgedruckt in: Ders.: Deutsche Politikwissenschaftler in der Emigration. Studien zu ihrer Akkulturation und Wirkungsgeschichte. Mit einer Biographie. Opladen 1996, S. 166–196, hier S. 177 ff; monografisch Frank Schale: Zwischen Engagement und Skepsis. Eine Studie zu den Schriften von Otto Kirchheimer. Baden-Baden 2006.
[44] Vgl. explizit Ulrich Lappenküper: Zwischen „Sammlungsbewegung“ und „Volkspartei“. Die CDU 1945–1969, in: Gehler/Kaiser/Wohnout (Hg.): Christdemokratie in Europa im 20. Jahrhundert, S. 385–398; generell zeitgenössisch Peter Molt: Wertvorstellungen in der Politik. Zur Frage der Entideologisierung der deutschen Parteien, in: Politische Vierteljahresschrift 4 (1963), S. 354–369.
[45] Zu dieser Position grundlegend Maier: Revolution und Kirche, S. 20 ff.