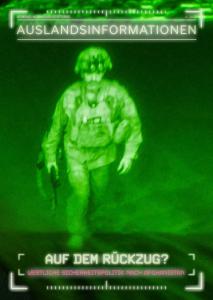Ausgabe: 1/2022
Auf mehr als 200 Kilometern Frontlänge begann am 27. September 2020 ein weiterer, dritter Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien um die Enklave Bergkarabach. Er endete am 9. November 2020 mit einem vorläufigen Waffenstillstandsabkommen unter der Ägide des Präsidenten der Russischen Föderation. Obwohl sich die Europäische Union und insbesondere die Mitgliedstaaten der sogenannten Minsk-Gruppe der OSZE überrascht zeigten, war jedem, der sich mit diesem Konflikt näher befasst, klar, dass es ein Krieg „mit Ansage“ war. Diesmal endete er vorläufig mit einer fast schon als verheerend zu bezeichnenden Niederlage der Armenier in Bergkarabach und mithin für die Republik Armenien. Das eigentliche Konfliktgebiet Bergkarabach ist jetzt zu einem guten Drittel unter der Herrschaft aserbaidschanischer Truppen, die nur wenige Kilometer vor der Hauptstadt der Enklave, Stepanakert, Stellung bezogen haben. Die historische Hauptstadt Bergkarabachs, Schuscha (Aserbaidschanisch) bzw. Schuschi (Armenisch), ist vollständig in der Hand Aserbaidschans. Dieser Umstand ist als Symbol in einer an Symbolen nicht gerade armen Auseinandersetzung kaum zu unterschätzen.
1994 hatte Armenien insgesamt sieben unmittelbar an Bergkarabach grenzende aserbaidschanische Regionen besetzt und sie zu einer militärischen „Pufferzone“ erklärt. Die sieben Regionen, auf die Armenien in den letzten 30 Jahren offiziell nie einen völkerrechtlich begründeten Anspruch für sich erhoben hatte, kamen in der Folge des jüngsten Krieges nunmehr unter die Kontrolle Bakus. Der vollständige Verlust der – aus armenischer Sicht – militärischen „Pufferzone“ war das eine. Das andere, viel dramatischere Ergebnis dieses Waffengangs – wiederum aus armenischer Sicht – war der Verlust gut eines Drittels des eigentlichen Konfliktgebiets Bergkarabach. Die am 9. November verhandelte und am Folgetag offiziell in Kraft getretene Vereinbarung zwischen den Republiken Aserbaidschan, Armenien und der Russischen Föderation ist formell eine Waffenstillstandsvereinbarung. Russland wurde zur Kontrolle des Waffenstillstands das Recht zu einer Friedensmission zugestanden, die vor allem einen fünf Kilometer breiten Korridor zwischen der Hauptstadt Bergkarabachs und der Grenze zur Republik Armenien sichern soll – der sogenannte Latschin-Korridor. Umgekehrt sollen die Armenier den Aserbaidschanern eine direkte Verbindung zwischen Aserbaidschan und der Exklave Nachitschewan zugestehen. Demnach hätten Aserbaidschaner das Recht, Hoheitsgebiet der Republik Armenien zu durchqueren.
Keine Sicherheitsgarantien für die Armenier
Ein weiteres Detail mit erheblicher Sprengkraft versteckt sich in der vereinbarten Laufzeit des Waffenstillstandsabkommens. Dieses gilt für fünf Jahre. Wenn entweder Aserbaidschan oder Armenien vor Ablauf dieser Frist das Abkommen kündigen, endet umgehend auch die Friedensmission Russlands. Aus Sicht der Armenier bedeutet dies, dass bei einer vorzeitigen Kündigung des Abkommens durch Aserbaidschan die Armenier in Bergkarabach der vollumfänglichen Administration Bakus ausgesetzt wären – ohne Aussicht auf eine Unterstützung durch russische Truppen. Damit wird gerade der für die Armenier in Bergkarabach entscheidende Anspruch, nämlich die Frage nach Sicherheitsgarantien, völlig außer Kraft gesetzt.
Abb. 1: Aktueller Territorialzuschnitt
Quelle: Eigene Darstellung, Karte: Natural Earth.
Das laute Schweigen der internationalen Gemeinschaft
Anlässlich des Gipfeltreffens zur Östlichen Partnerschaft am 15. Dezember 2021 in Brüssel veröffentlichte der Rat der Europäischen Union eine gemeinsame Erklärung aller Teilnehmer. Im Anhang wurden „Prioritäten der Östlichen Partnerschaft für die Zeit nach 2020“ formuliert. Dort heißt es, dass im Rahmen einer gemeinsamen Sicherheits- und Stabilitätspolitik künftig neben zivilen auch militärische Missionen unterstützt werden sollen. Ein Jahr nach dem vorläufigen Ende des dritten Bergkarabachkrieges klingt das einerseits ergebnisorientierter als bisher. Andererseits stellt sich die Frage nach der Ernsthaftigkeit solcher Erklärungen. Insbesondere die Republik Armenien fühlte sich in dem fast siebenwöchigen Krieg vom September bis November 2020 von der internationalen Gemeinschaft alleingelassen. Es ist in der Tat erstaunlich, wie hilf- und einfallslos die Europäische Union dem Krieg vom 27. September bis 9. November zusah. Es war immerhin ein Krieg zwischen zwei Akteuren der Östlichen Partnerschaft und darüber hinaus ein mit hochmodernen Waffen geführter. Letzteres war der Grund, warum sich zumindest die Bundeswehr bzw. das deutsche Verteidigungsministerium für den Krieg interessierte. Vom Deutschen Bundestag, dem Auswärtigen Ausschuss oder dem für Menschenrechte erreichten nur allgemeine Erklärungen, gerichtet an beide Kriegsparteien, die Öffentlichkeit. Während des (vorläufig) letzten Krieges im Herbst 2020 war von der sogenannten Minsker Gruppe der OSZE überhaupt nichts zu hören. Diese ist eigentlich die wichtigste Institution zur Vermittlung eines Friedens zwischen den Konfliktparteien.
Irreführende Dominanz des geopolitischen Narrativs in der gegenwärtigen Berichterstattung
In der medialen Berichterstattung und größtenteils auch in wissenschaftlichen Beiträgen über den Bergkarabachkonflikt überwiegt seit Langem ein geopolitisches Narrativ zur Erklärung nahezu aller Ursachen. Demnach erscheinen die beiden Hauptakteure letztendlich nur als Objekte im Spiel der regionalen Mächte Russland, Türkei und Iran. Nun ist überhaupt nicht zu bezweifeln, dass Russland und die Türkei mittels des Bergkarabachkonflikts versuchen, eigene Ziele zu verfolgen, und dass mit Iran ein weiterer Akteur in der regionalen Geopolitik wieder in Erscheinung getreten ist. Selbst Israels massive Waffenverkäufe an Aserbaidschan inklusive der letztlich kriegsentscheidenden Drohnen dürften nicht nur geschäftlichen Interessen gedient haben.
Aber diese geopolitische Dominanz in der Berichterstattung verstellt allzu häufig den Blick auf die internen Prozesse Aserbaidschans und Armeniens. Die beiden Länder und die Enklave Bergkarabach sind nicht nur Objekte, sondern in viel höherem Maße Subjekte der gewaltsamen Prozesse. Die geopolitische Situation in dieser Region hat sich im 20. Jahrhunderts mehrfach gewandelt, insbesondere das Verhältnis zwischen dem Russischen Reich respektive dem Sowjetimperium und dem Osmanischen Reich bzw. der Türkei. Der bilaterale Konflikt um die Enklave hingegen ist seit gut einhundert Jahren derselbe. Damit soll auch der diesem Beitrag zugrundeliegende zeitliche und politische Rahmen umrissen sein.
Einhundert Jahre Bergkarabachkonflikt
Die Etablierung der bolschewistischen Macht im südlichen Kaukasus brachte zunächst Bewegung in die sogenannte Armenische Frage. Die panturkistisch motivierte späte Nationenwerdung Aserbaidschans, der Beginn der sowjetischen Nationalitätenpolitik im Südkaukasus und die Nichtbeantwortung der „Armenischen Frage“ sind die unmittelbaren Ursachen für den Beginn des eigentlichen Bergkarabachkonflikts. Dieser ist also rund einhundert Jahre alt. Damit ist dieser Konflikt der älteste innerethnische im postsowjetischen Raum. Die christlichen Armenier passten in die panturkistischen Vorstellungen nicht hinein, schon gar nicht mit einem eigenen Territorium, das alle kompakt von Armeniern besiedelten Gebiete in einem Staat zusammengebracht hätte. Diese Überlegung gehört zur Grundkonstellation des heutigen Konflikts. In einer Zeit, als kurz nach dem Ersten Weltkrieg die Idee des Selbstbestimmungsrechts der Völker international Konjunktur hatte, wurde genau diese den Armeniern vorenthalten.
70 Jahre spielte sich der Konflikt unter dem Schutzschild der Sowjetunion ab. Dank einer starken Zentralmacht blieb der Konflikt in dieser Zeit insofern „friedlich“, als dass die Auseinandersetzung nicht mit offener und massiver Waffengewalt ausgetragen werden konnte. Aber auch in der Sowjetzeit wurde der Bergkarabachkonflikt keineswegs befriedet. Wenn überhaupt, dann passt der allseits und in der Gegenwart arg strapazierte Terminus frozen conflict auf die Zeit des sowjetischen Imperiums.
Ende des Sowjetimperiums – Chaos und nationale Wiedergeburt
Jedoch spätestens seit 1988 entwickelte sich der Konflikt zwischen den beiden Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien zu einem opferreichen Krieg. Unabhängig von allen Diskussionen über völkerrechtliche Aspekte, das Territorialprinzip als wichtigstes Argument der aserbaidschanischen Seite oder über das Selbstbestimmungsrecht der Völker als Kern des armenischen Narrativs wurden jeweils neue Realitäten mit Waffengewalt geschaffen. Dies war der Fall im ersten Bergkarabachkrieg 1991 bis 1994, im zweiten im April 2016, hier allerdings eher mit einer Festigung des 1994 geschaffenen Status quo, und schließlich im dritten Krieg vom 27. September bis 9. November 2020. Gerade vor diesem Hintergrund reicht es nicht aus, den Konflikt um Bergkarabach einen „eingefrorenen“ zu nennen, weil eine solche Apostrophierung den falschen Eindruck suggeriert, Waffenstillstände würden automatisch zu Verhandlungen führen. Gerade beim Bergkarabachkonflikt zeigt sich, dass in den Zeiten zwischen den Waffenstillständen bezüglich einer Konfliktlösung kaum etwas substanzielles passiert ist. Wer auf die jetzige Situation und die durch den jüngsten Kriegsverlauf eingetretenen Folgen schaut, wird sicher nicht zu dem Ergebnis kommen können, dies sei ein Abschluss des Konflikts. Völkerrechtlich handelt es sich um keinen Friedensvertrag, sondern um einen vorläufigen Stopp der Kampfhandlungen.
Vor allem muss beachtet werden, dass auch mit diesem Waffenstillstandsabkommen der rechtliche Status von Bergkarabach in keiner Weise geregelt wurde. Dies wäre aber die Grundvoraussetzung, um das langfristige Problem für die in Bergkarabach lebenden Armenier, nämlich deren Sicherheit, zu gewähren. Dieses Ziel scheint nunmehr in noch größere Entfernung gerückt zu sein. Aserbaidschan sieht auch weiterhin keinen Anlass, über den rechtlichen Status Bergkarabachs überhaupt Verhandlungen zu führen. Mehr als ein Drittel des Territoriums von Bergkarabach steht nunmehr unter direktem Einfluss Bakus.
Sowjetisierung und Nationalisierung als Katalysatoren des Konflikts
Die Entstehung der beiden Nationen Aserbaidschan und Armenien ist nur im Kontext des Ersten Weltkrieges zu verstehen. Insofern spielen in diesem Fall geopolitische und strategische Überlegungen insbesondere auf osmanischer und russischer Seite eine herausragende Rolle. Zweifellos wurde die Entstehung einer aserbaidschanischen Nation im Wesentlichen durch das Osmanische Reich befördert. Armenien wiederum hatte im Zweifelsfall Russland an seiner Seite, obwohl das Verhältnis beider nie spannungsfrei war. Schon im zaristischen Russland hatte die Führung in Sankt Petersburg niemals Interesse daran, „die überwiegend armenisch besiedelten Gebiete im Südkaukasus zu einer administrativen Einheit zu vereinigen. Auf keinen Fall wollte sie dem armenischen Bestreben nach Bildung eines Nationalstaates Vorschub leisten“. Die sogenannte Armenische Frage war für die regionalen Mächte stets eine heikle. Auch die Bolschewiki in der Sowjetunion hatten kein Interesse daran, das Territorium der Sozialistischen Sowjetrepublik Armenien den tatsächlichen Siedlungsgebieten der Armenier anzupassen, obwohl dies mit Blick auf die Geografie im Südkaukasus durchaus möglich gewesen wäre und eigentlich der bolschewistischen Auffassung von Nation und Imperium entsprochen hätte.
Es gehört zu den Paradoxien der Geschichte des 20. Jahrhunderts, dass die Bolschewiki als „Avantgarde“ der marxistisch-leninistischen Ideologie bei der Organisation ihres Sowjetreiches im Grunde genommen ganz unmarxistisch vorgingen. Die Einwohner des Imperiums waren nicht nur Bürger der Sowjetunion, sondern gleichzeitig auch einer bestimmten Nation, die wiederum im Wesentlichen ethnisch definiert war oder sein sollte. Von einem sauberen „marxistischen Klassenstandpunkt“ aus ist eine solche Vorgehensweise bei der Organisation des Staates sehr weit entfernt. Nationen sollten ja gerade irrelevant werden. Damit hatten aber die Bolschewiki – vielleicht unbewusst – einen Schwelbrand gelegt, der mit dem Ende ihres Imperiums zu einem Großfeuer anwuchs, das bis heute längst nicht gelöscht ist, ja nicht einmal unter Kontrolle zu sein scheint.
Politik und Propaganda in den Steinbrüchen der Geschichte
Der lange Schatten des Genozids von 1915
Schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Südkaukasus immer mehr zum Zufluchtsort für Armenier aus dem gesamten Osmanischen Reich. Die im heutigen Diskurs über den Bergkarabachkonflikt immer wieder zu nennenden Orte bzw. Städte wie Eriwan, Zangezur, Nachitschewan, Stepanakert, Schuscha bzw. Schuschi und eben Karabach waren bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert die geografischen Hotspots für den sich dann entwickelnden Konflikt um Bergkarabach. Im Ergebnis des Ersten Weltkrieges, der Oktoberrevolution und des Ausgreifens der bolschewistischen Herrschaft auf den Südkaukasus um das Jahr 1920/1921 das erst durch den Sieg im Bürgerkrieg ermöglicht wurde, entstand in der Region eine explosive Mischung.
Der Südkaukasus wurde nach 1915 stärker noch als zuvor Zufluchtsort für die Überlebenden des Völkermords an den Armeniern. Deren Erinnerungsnarrative und -kultur wurden in der Folgezeit für die Armenier zu einer wesentlichen Triebkraft im Bergkarabachkonflikt – bis heute. In der kurzen Zeit des Bestehens der ersten Republiken Aserbaidschans und Armeniens 1918 bis 1920 entwickelte sich eine Gewaltspirale zwischen beiden Völkern mit gegenseitigen Massakern an unterschiedlichen Orten des südlichen Kaukasus. So wurden im März 1918 in Baku und einigen umliegenden Orten Tausende Aserbaidschaner Opfer von Pogromen durch überwiegend armenische Einheiten. Eine besonders schlimme Rolle spielte dabei der Anführer der „Bakuer Kommune“ Stepan Schahumjan, ein armenisch-stämmiger georgischer Bolschewik. Im September 1918 wiederum fand ein Massaker aserbaidschanischer Truppen an Armeniern statt, das mit tätiger Unterstützung der Osmanen begangen wurde, womit die Armenier ein entsetzliches Déjà-vu erlebten. Was das Ausmaß anbelangt, so müsste für diesen Anfang des gewalttätigen Bergkarabachkonflikts zumindest das Massaker vom März 1920 erwähnt werden, bei dem etwa 22.000 Opfer auf armenischer Seite zu beklagen waren.
Kollektives Gedächtnis und Traumatisierung
Es wäre müßig, alle diese Ereignisse von Massakern, Pogromen und Gegenmassakern an dieser Stelle aufzuzählen. Es sollen nur die Anfänge des gewaltsamen Konfliktes umrissen werden, die von nun an die Auseinandersetzung um Bergkarabach prägten. Bis zum heutigen Tag ist das gegenseitige Aufzählen und Vorhalten von Pogromen und tatsächlichen oder vermeintlichen Gegenpogromen der letzten einhundert Jahre probates Mittel der politischen Akteure, eigenes Handeln im Bergkarabachkonflikt zu legitimieren. In der gegenwärtigen Auseinandersetzung beziehen sich diese „Legitimierungen“ in der Regel auf die gegenseitigen Pogrome seit 1988. Für einen Schritt näher an einen sinnvollen Dialog ist aber auch damit nichts gewonnen.
Bergkarabach – vergiftetes Erbe zaristischer und sowjetischer Nationalitätenpolitik
Die endgültige Übernahme des Südkaukasus durch die Bolschewiki wurde zum Kulminationspunkt des Bergkarabachkonflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien. Letztere hatten sich kurzzeitig als nationale Republiken organisiert. Diese Episode dauerte allerdings nur bis 1920. Dann erbten die Bolschewiki auch den Bergkarabachkonflikt. Für die Armenier war dieser Machtwechsel, der ja auch andere politische und ideologische Prämissen und Forderungen mit sich brachte, zunächst nicht nur negativ konnotiert. Im Grunde genommen brauchten die Armenier die Bolschewiki „nur“ an deren eigene Forderungen zu erinnern. Mit Blick auf die rechtliche Stellung der „Völker der Sowjetunion“ wurde schon vor der Oktoberrevolution das „Selbstbestimmungsrecht der Völker“ in Deklarationen massiv betont.
Jedoch spielte bei der territorial-nationalen Aufteilung des Südkaukasus jetzt schon die bolschewistische Nationalitätenpolitik eine wichtige Rolle. Der zuständige „Volkskommissar für Nationalitätenfragen“, J.W. Stalin, griff letztendlich persönlich in die Verhandlungen ein. Offenkundig wollte die Führung der damals noch existierenden Russischen Kommunistischen Partei vermeiden, den ziemlich kompakt auf einem Territorium lebenden Armeniern ein einheitliches Staatsgebiet zuzugestehen. Das im Großen und Ganzen heute existierende Territorium der Republik Armenien wurde zur Armenischen Sozialistischen Sowjetrepublik (SSR) mit Eriwan als Hauptstadt. Nachitschewan hingegen, das seit 1849 zusammen mit Eriwan zum „Armenischen Oblast“ innerhalb des Zarenreiches gehörte, wurde losgelöst und zum autonomen Territorium erklärt. Aus aserbaidschanischer Sicht handelt es sich selbst nach den eigenen Narrativen um eine Exklave, die keine direkte Grenze mit Aserbaidschan hat. Mit der Isolierung Bergkarabachs wurde das relativ kompakte Siedlungsgebiet der Armenier dreigeteilt – Armenien, Nachitschewan und Bergkarabach.
Die ganz wesentlich auf türkischen Druck zustande gekommene Vereinbarung im Rahmen des russisch-türkischen Vertrags vom 16. März 1921 enthielt eine bemerkenswerte Klausel. Demnach sollte das „autonome Territorium“ Nachitschewan dem Protektorat Aserbaidschans unterstellt und „niemals einem dritten Staat“ überlassen werden. Nach Lage der Dinge konnte mit diesem „dritten Staat“ nur Armenien gemeint sein. Mit etwa 50.000 Einwohnern in Nachitschewan hatten die Armenier eine relative Mehrheit, die sich allerdings durch diese Regelungen nunmehr völlig isoliert sah.
Eine fatale Entscheidung mit Stalins Handschrift
Bergkarabach hingegen war in noch viel deutlicherem Maß ein Gebiet, das vor rund einhundert Jahren überwiegend von Armeniern bewohnt war, deren Bevölkerungsanteil etwa 90 Prozent betrug. Im Sommer des Jahres 1921 stand die Entscheidung über den Status von Bergkarabach an. Aus bolschewistischer Sicht war das dafür relevante Gremium das Kaukasische Büro des Zentralkomitees der Russländischen Kommunistischen Partei (Bolschewiki). Was am 4. und 5. Juli 1921 bei diesen Verhandlungen geschah, zeigt die ganze Komplexität und Verworrenheit bei der Suche nach den Ursachen dieses hier zur Debatte stehenden Konflikts.
In der Sitzung am 4. Juli entschied das Gremium, Bergkarabach der Armenischen SSR zuzuordnen. Bei der Sitzung am 5. Juli, an der auch Stalin persönlich teilnahm, obwohl er dem Gremium formell gar nicht angehörte, wurde nochmals abgestimmt und mit einer Stimme Mehrheit Bergkarabach der Aserbaidschanischen SSR zugesprochen. Man kann davon ausgehen, dass wirtschaftliche bzw. administrative Überlegungen bei dieser Entscheidung eine Rolle spielten. Aber Stalin dürfte es auch darum gegangen sein, die Armenische SSR nicht allzu groß werden zu lassen. Das war schon die Politik des Zarenreiches gewesen.
Der Gordische Knoten im Bergkarabachkonflikt – Territorialprinzip versus Selbstbestimmungsrecht der Völker und die Perzeption im Westen
In der rhetorischen Auseinandersetzung um den Bergkarabachkonflikt stehen sich aserbaidschanische und armenische Narrative so diametral gegenüber, dass es kaum noch sinnvoll erscheint, die Diskussionen neu zu beleben. Wer aber wie die EU und Deutschland bisher militärische Mittel zur Konfliktlösung ausschließt, muss dann zumindest positioniert und bereit sein, den politischen Dialog auf breiter Ebene zu führen. Wie soll ansonsten ein anspruchsvolles Programm wie das der Östlichen Partnerschaft umgesetzt werden?
Die Frage der Legitimität der beiden völkerrechtlichen Narrative „Unverletzlichkeit des Territoriums“ und „Selbstbestimmungsrecht der Völker“ bzw. deren konkrete Anwendbarkeit im Fall Bergkarabach muss diskutiert werden. Sie ist alles andere als geklärt. Spätestens seit Beginn des ersten Bergkarabachkriegs (1991 bis 1994) zeigt sich hier eine Diskrepanz in der Wahrnehmung sowohl der direkt Beteiligten als auch der beobachtenden Dritten zur tatsächlichen Situation und zum Stand der Forschung. Zu diesen Dritten gehören die Deutschen, die nicht nur evident am Programm der Östlichen Partnerschaft beteiligt, sondern auch Mitglied der Minsker Vermittlergruppe der OSZE sind. Wie steht es nun um die Perzeption des Bergkarabachkonflikts in Deutschland? Wer hat Recht mit dem Anspruch auf die gut 4.400 Quadratkilometer Land, in denen zuletzt, also bis zum 27. September 2020, knapp 150.000 Armenier lebten?
Das trügerische Gefühl, „neutral“ zu sein
Das aserbaidschanische Narrativ stützt sich auf das völkerrechtliche Prinzip der territorialen Integrität. Untermauert wird dieser Standpunkt immer wieder mit dem Hinweis auf vier UN-Sicherheitsratsbeschlüsse aus dem Jahr 1993. Es handelt sich um die Resolutionen 822, 853, 874 und 884. In diesen wird Armenien aufgefordert, die sieben das eigentliche Bergkarabach umschließenden Regionen, die von den Armeniern 1991 bis 1994 erobert worden waren, wieder zu räumen. Zu Gewaltverzicht werden beide Seiten gleichermaßen aufgefordert. Aus aserbaidschanischer Perspektive sollen jedoch die Bergkarabach-Armenier in keinem Fall als eigenständige Subjekte jeglicher Verhandlungen akzeptiert werden. Dieser Standpunkt wird in zahllosen Pressemitteilungen, Positionspapieren und Statements seitens der Aserbaidschaner immer wiederholt. Viele internationale Akteure in den Gremien und Institutionen der EU, OSZE oder im Europarat haben sich diese Lesart zu eigen gemacht.
Das armenische Narrativ betont hingegen das völkerrechtliche Prinzip der Selbstbestimmung der Völker, das in der Zeit der beginnenden Sowjetisierung und mithin der bolschewistischen Nationalitätenpolitik durchaus eine gewichtige Rolle spielte. Aber die armenische Argumentation ist deutlich komplizierter und erfordert beim Rezipienten die Bereitschaft, die komplexe Genesis der „Armenischen Frage“ mit einzubeziehen, beispielsweise das sich aus den Erfahrungen des Genozids 1915 ergebende Sicherheitsbedürfnis der Armenier. Muss diese Argumentation deshalb falsch sein und darf mithin ignoriert werden? Bis heute gibt es seitens internationaler Akteure kein belastbares Angebot, wie die Sicherheit der Bergkarabach-Armenier gewährleistet werden könnte. Nach dem letzten Krieg hängt diese umso mehr an einem dünnen Faden.
Eine alleinige Legitimation aufgrund des Territorialprinzips im Sinne des aserbaidschanischen Bergkarabach-Narrativs ist aber weder völkerrechtlich noch historisch zu begründen. Das ist zwar keine völlig neue Erkenntnis. Aber sie spielt bei den öffentlichen Auseinandersetzungen kaum eine Rolle. Vermeintlich „neutrale“ Sichtweisen bedienen letztendlich ausschließlich das aserbaidschanische Narrativ.
Otto Luchterhandt, viele Jahre Professor für Internationales Recht in Hamburg und aus völkerrechtlicher Perspektive wie kein anderer mit dem Thema befasst, untersuchte in zahlreichen Publikationen den Status von Bergkarabach. Mit Bezug auf das sogenannte Austrittsgesetz vom April 1990 resümierte er: „Dass damit die Grundlage der 1921 aus machtpolitischem Kalkül getroffenen Entscheidung über Karabach weggefallen war, ist den Hauptakteuren in der internationalen Staatengemeinschaft – bis heute – verborgen geblieben.“ Das „Austrittsgesetz“ vom April 1990 regelte die Formalien für den Fall, dass eine Sowjetrepublik aus dem Verband der Sowjetunion austreten wollte. Diese Möglichkeit beinhalteten zwar auch schon die früheren Verfassungen der Sowjetunion, freilich ohne dass diese Option jemals in Anspruch genommen worden wäre. Aber das „Austrittsgesetz“ – oder wie die zusätzliche Passage genau formuliert ist: „über das Verfahren der Entscheidung der Fragen, die mit dem Austritt einer Unionsrepublik verbunden sind“ – ging darüber hinaus, denn es regelte auch, was mit den auf dem Territorium der Sowjetrepubliken liegenden autonomen Gebietskörperschaften geschehen solle.
Demnach konnte eine Sowjetrepublik den Austritt aus der Sowjetunion erklären, so wie es rein theoretisch schon seit der ersten Sowjetverfassung möglich war. Mit dem sogenannten Austrittsgesetz vom April 1990 sollte auch das Schicksal der innerhalb einer autonomen Gebietskörperschaft lebenden Menschen völkerrechtlich geklärt werden. Im konkreten Fall stellte sich die Frage: Was würde mit den Armeniern in Bergkarabach geschehen, wenn sich die Titularnation Aserbaidschan per Referendum aus der Sowjetunion löst? Gemäß Austrittsgesetz müssten in diesem Fall die Bewohner Bergkarabachs per Volksentscheid darüber abstimmen, ob sie weiter zu dieser Sowjetrepublik gehören oder als selbständige Einheit die Titularnation verlassen bzw. weiter zur Sowjetunion gehören wollten. Genau diese Möglichkeit nahmen die Armenier von Bergkarabach in Anspruch, als sie am 10. Dezember 1991 in einem ordentlichen und freien Verfahren ihre weitere Zugehörigkeit zur Sowjetunion erklärten. Dieses wurde aber von Aserbaidschan nicht anerkannt bzw. schlichtweg ignoriert.
Aserbaidschans Unabhängigkeitserklärung durch den Obersten Sowjet der Aserbaidschanischen SSR vom 30. August 1991 vollzog sich im Rahmen des noch geltenden sowjetischen Rechts, die Sowjetunion als völkerrechtliches Subjekt bestand schließlich noch. Demnach hätte Aserbaidschan auch das Referendum der Bergkarabach-Armenier anerkennen müssen. Wenn also Baku sein Recht auf Austritt aus der Sowjetunion im Rahmen des sowjetischen Rechts in Anspruch nahm, das der Bergkarabach-Armenier jedoch ignorierte, dann würde damit das Austrittsverfahren Aserbaidschans rechtlich „in der Luft“ hängen.
Deutschlands diffuse Positionierung in diesem Konflikt
Kaum jemand in Deutschland würde ernsthaft mit dem Gedanken spielen, ein militärisches Eingreifen im Bergkarabachkonflikt auch nur in Erwägung zu ziehen. Es stellt sich die Frage, was das Vertragswerk der Östlichen Partnerschaft vorgesehen hat für den Fall eines Krieges zwischen zweien ihrer Mitgliedsländer. Die bisherigen Angebote seitens der EU im Rahmen des Programms der Östlichen Partnerschaft reichen längst nicht aus, um deren selbst gesteckte Ziele auch nur annähernd zu erreichen. Der Bergkarabachkonflikt spielt für Aserbaidschan und Armenien sowohl außen- als auch innenpolitisch eine herausragende Rolle. Allein deshalb müsste das Programm der Östlichen Partnerschaft reagieren und zwar mit konkreten, das Thema auch beim Namen nennenden Angeboten.
Das öffentliche Interesse am Bergkarabachkonflikt scheint in Deutschland nicht groß zu sein. Wenn man entsprechende öffentliche Veranstaltungen während und unmittelbar nach dem (vorläufigen) Ende des letzten Krieges betrachtet, so fiel auf, dass sich an den Narrativen und Frontstellungen nichts geändert hat. Neben den mit viel rhetorischen Nebelkerzen begleiteten Diskussionen über die Fragen, wer diesen Waffengang am 27. September begonnen und wer völkerrechtlich verbotene Waffen eingesetzt habe oder ob syrische Söldner beteiligt waren, wie amerikanische und russische Geheimdienste unabhängig voneinander feststellten, kam es immer wieder auch zum Streit über den völkerrechtlichen Hintergrund des Konflikts. Es ist irritierend, dass die oben erwähnten, rezenten Analysen keinen bzw. nur einen sehr geringen Einfluss auf die Diskussionen haben. Hinzu kommt, dass die seit mindestens einem Jahrzehnt bekannten Vorgänge, die unter dem Begriff „Kaviar-Diplomatie“ laufen, nicht konsequent verfolgt und aufgeklärt wurden.
Es wäre schon ein Fortschritt, wenn deutsche Politiker besser informiert wären über die gegenwärtige Lage im Südkaukasus. Diese ist nicht zu verstehen, ohne die zwei wesentlichen historischen Eckpunkte des Bergkarabachkonflikts in den Blick zu nehmen – die Verweigerung der Selbstbestimmung für die Armenier am Anfang der Sowjetunion und das „Austrittsverfahren“ am Ende des Imperiums. Wenn es um die Frage geht, welche Legitimität jeweils die beiden Narrative haben, historisch und völkerrechtlich, dann wäre es an der Zeit, das bloße Wiederholen des aserbaidschanischen kritisch zu hinterfragen. Der permanente Verweis auf die vier UN-Resolutionen von 1993 ist mit Sicherheit nicht der Weisheit letzter Schluss. Damit allein ist in der heutigen Situation gar nichts zu erklären und im Sinne einer beidseitig anerkannten Friedenslösung erst recht nichts zu gewinnen.
Ein Hinweis auf die Legitimität des Austrittsverfahrens Aserbaidschans und Bergkarabachs findet sich in keiner offiziellen Erklärung beispielsweise des Bundestags. Die deutsche Politik oder die Mehrheit derjenigen, die qua Zuständigkeit mit dem Bergkarabachkonflikt befasst sind, scheinen mehrheitlich weiterhin das aserbaidschanische Narrativ zu bevorzugen. Dessen ideelle Grundierung geht auf die strategischen Überlegungen J.W. Stalins und der Bolschewiki am Anfang der Sowjetunion zurück. Sollten in einer werteorientierten Außenpolitik nicht auch solche Fragestellungen eine Rolle spielen?
Der Westen zwischen selbstgefälliger Friedensrhetorik, politischem Phlegma und diplomatischer Routine
Die für die Lösung des Konflikts zuständige „Minsk-Gruppe“ der OSZE hat während des letzten Krieges vom 27. September bis 9. November 2020 nicht eine substanzielle Initiative ergriffen, um nachhaltig den Konflikt zu befrieden. Auch die Europäische Union, die immerhin über diverse bi- und multilaterale Vereinbarungen seit zwei Jahrzehnten mit den Ländern des südlichen Kaukasus verbunden ist, leistete keinen sichtbaren Beitrag, sondern hüllte sich in Schweigen. Zum Europarat als wichtigster Institution zur Einhaltung der Menschenrechte gehören auch die vollwertigen Mitglieder Armenien, Aserbaidschan, Türkei und seit Kurzem wieder Russland.
Russland ist seit gut 30 Jahren der einzige internationale Faktor, der in der Lage wäre, eine friedliche Lösung des Konflikts zu befördern. Die Waffenstillstandsverträge von 1994, 2016 und zuletzt der vom 9. November 2020 sind alle durch Russlands Initiativen zustande gekommen. Seit Inkrafttreten des Waffenstillstandsabkommens am 10. November 2020 ist die Sicherheitslage der Armenier in Bergkarabach äußerst fragil. Ohne zu dramatisieren, muss man festhalten: Derzeit hängt die Sicherheit der Armenier in Bergkarabach ausschließlich von den etwa 2.000 Soldaten der russischen Friedensmission ab.
Darüber hinaus ist Bergkarabach einer der wichtigsten Orte früher Christenheit. Die Hinterlassenschaften in Gestalt von Kirchen, Klöstern und Friedhöfen reichen bis ins fünfte Jahrhundert zurück. Die Unversehrtheit dieser einmaligen Zeugnisse christlicher Kultur kann derzeit nur noch von Russland garantiert werden. Vor dem Hintergrund der immer wieder zitierten und heraufbeschworenen europäischen „Wertegemeinschaft“ ist es verstörend, dass auch dieser Aspekt im Westen kaum eine Rolle spielt.
Sollte der Westen ernsthaft gewillt sein, diesen Konflikt zwischen Aserbaidschanern und Armeniern zu befrieden, dann muss mit Russland gesprochen werden. Während des deutschen OSZE-Vorsitzes 2016 gab es Angebote Russlands, die diesbezüglich auf eine Arbeitsteilung hinausgelaufen wären. Daran könnte angeknüpft werden. Allerdings haben sich die westeuropäisch-russischen Beziehungen seither nicht zum Guten entwickelt.
Seit Ende der Sowjetunion hat zwischen Aserbaidschanern und Armeniern kein wirklicher Dialog stattgefunden. Es gab allenfalls ein Bekanntgeben sich diametral gegenüberstehender Standpunkte. Deutschland könnte einen wesentlichen Beitrag leisten, um erst einmal die Voraussetzungen für den Beginn eines Dialogs zu schaffen. In einem solchen Dialog kann es nicht darum gehen, entweder das Territorialprinzip oder das der Selbstbestimmung der Völker zu favorisieren. Die äußerst komplexe Gemengelage erfordert politische Lösungen.
Dr. Thomas Schrapel ist Leiter des Regionalprogramms Politischer Dialog Südkaukasus der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Tiflis.
Für eine vollständige Version dieses Beitrags inkl. Quellenverweisen wählen Sie bitte das PDF-Format.