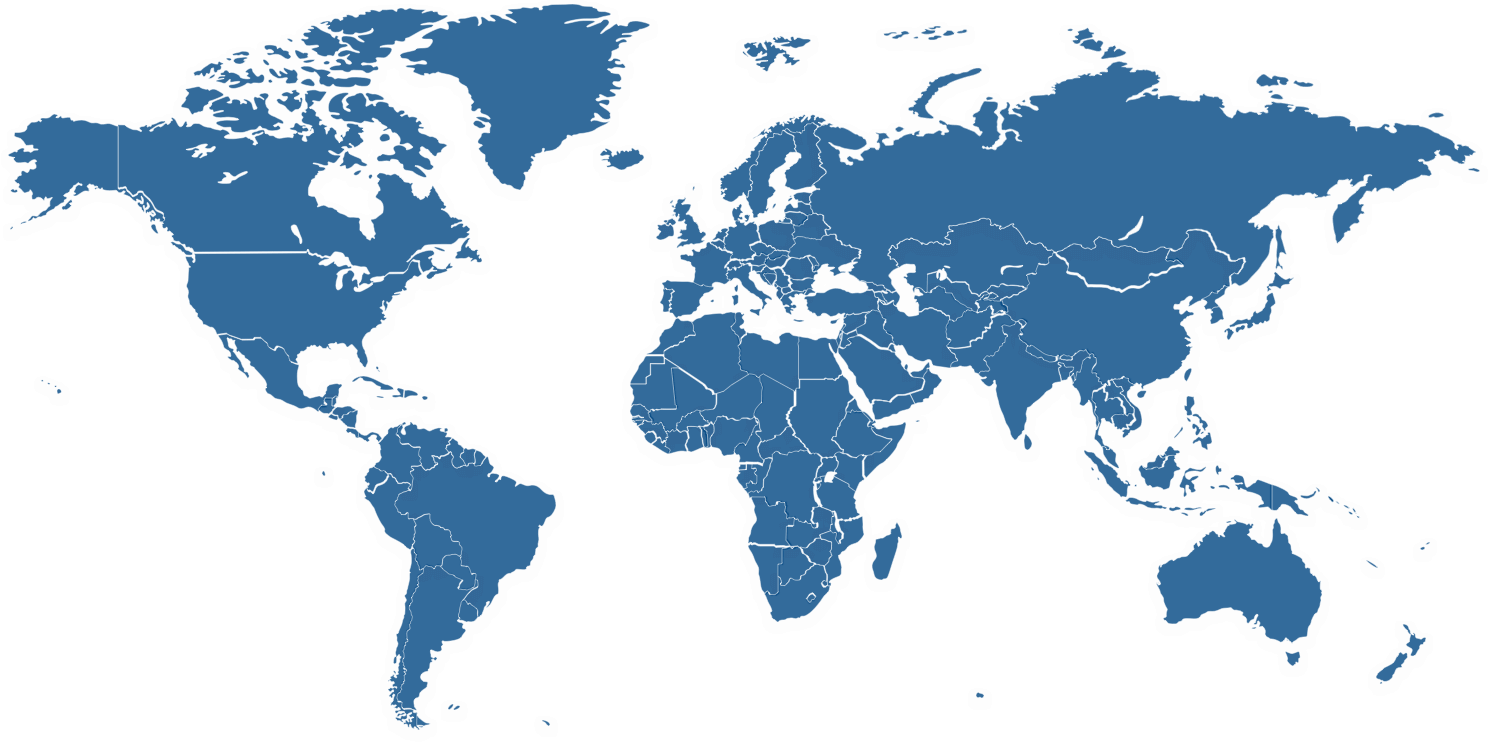Am Ende war das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen am 9. Februar dann doch knapper als von den meisten Umfrageinstituten vorhergesagt. Zwar fuhr Amtsinhaber Daniel Noboa nach Auszählung von 92 Prozent der Stimmen mit 44,3 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang das erwartet starke Ergebnis ein, seine wichtigste Gegenkandidatin Luisa González konnte jedoch mit 43,8 Prozent fast gleichziehen. Für einen Sieg bereits im ersten Wahlgang hätte der jüngste Staatschef Lateinamerikas entweder 50 Prozent plus eine Stimme oder aber über 40 Prozent und einen Abstand von zehn Prozentpunkten benötigt. Das Ergebnis zeigt also einerseits die große Unterstützung für den Präsidenten, andererseits jedoch auch die Beharrungskräfte der Unterstützer des im belgischen Exil lebenden ehemaligen linksautoritären Präsidenten Rafael Correa (2007-2017), als dessen Vertreterin González angetreten war.
Die unterschiedlichen Lesarten des Wahlergebnisses reißen jedoch damit nicht ab. Zwar verlor der sogenannte „Correismo“ zum ersten Mal überhaupt in seiner Geschichte die erste Runde einer Präsidentschaftswahl, erzielte aber dennoch sein bestes Ergebnis in einer ersten Präsidentschaftswahlrunde seit dem Ende des Correa-Regimes 2017. Die im sogenannten „Sozialismus des XI. Jahrhunderts“ verwurzelte politische Bewegung des in Ecuador wegen Korruption zu acht Jahren Haft verurteilten ehemaligen Staatspräsidenten konnte mehr als zehn Prozentpunkte besser abschneiden als bei der ersten Wahlrunde der außerordentlichen Wahlen 2023, die Daniel Noboa erst ins Amt gebracht hatten. Damals hatte Noboa bei einem deutlich weiter aufgefächerten Bewerberfeld nur 23,5 Prozent der Stimmen erhalten – Luisa González 33,1 Prozent.
Im Gegensatz zu vorherigen Wahlen führte die Polarisierung zwischen Noboa und dem Correismo dazu, dass weitere Kandidaten kaum eine Rolle spielten. Obwohl insgesamt sechzehn Kandidatinnen und Kandidaten zur Auswahl standen, konnte außer dem links-marxistischen Indigenenführer Leonidas Iza, der 5,3 Prozent der Stimmen enthielt, und der dem konservativen Spektrum zuzuordnenden Andrea González (2,7 Prozent) niemand die Ein-Prozent-Marke überspringen. Im miserablen Abschneiden vieler traditioneller politischer Bewegungen spiegeln sich die Schwäche des politischen Systems, das Fehlen von Reformen in Politik und Wahlrecht, sowie der immer noch allmächtige Personalismus in der Gesellschaft wider.
Überschattet wurden die Parlamentswahlen einmal mehr von der Gewalt. Allein im Januar verlor durchschnittlich jede Stunde ein Mensch in Ecuador gewaltsam sein Leben.1
Jugend stimmt für Noboa
Der 37jährige Noboa hat es trotz dieser schwierigen Bedingungen im Land geschafft, in seiner kurzen Amtszeit von knapp 14 Monaten einer Mehrheit der Bevölkerung das Gefühl zu vermitteln, dass er tatsächlich für einen neuen politischen Kurs steht und seinen Worten Taten folgen lässt. Vor allem die junge Wählerschaft zwischen 18 und 29 Jahren, die 20,22 Prozent der 13,7 Millionen Wahlberechtigten umfasst 2, war wohl – wie schon 2023 – für das Wahlergebnis maßgeblich. Immer wieder ist gerade bei jungen Menschen die Meinung zu hören, dass der Präsident in der kurzen Zeitspanne eines Jahres mehr erreicht habe als seine unmittelbaren Vorgänger im höchsten Staatsamt zusammen in den letzten Jahren.
Im von vielen strukturellen und akuten Problemen heimgesuchten Andenland haben die Menschen praktisch kein Vertrauen mehr in die Politik und seine Repräsentanten. Ungewöhnlicherweise liegen jedoch ausgerechnet auf Noboa, dem Sohn eines ehemaligen Präsidentschaftskandidaten und Inhabers des größten Bananenimperiums Ecuadors die Hoffnungen auf einen neuen Politikstil zur Überwindung der traditionellen Elite. Vor allem mit seiner Präsenz in den sozialen Medien und einer bereits bei den letzten Wahlen angewandten außergewöhnlichen Selbstinszenierung mit Pappmaché-Figuren, die ihn selbst darstellen, konnte er nicht nur die Jugend als Wählergruppe für sich mobilisieren. Allein in der Hauptstadt Quito und der Region der Sierra, die durch ihre Wählerschaft traditionell wahlentscheidend ist, sollen 1,5 Millionen solcher Noboa-Figuren kostenlos verteilt worden sein. Angehörige aller Altersgruppen haben sich einen „Noboa“ mit nach Hause genommen, Selfies gemacht und in ihren sozialen Netzwerken millionenfach geteilt.
Disruptiver Regierungsstil
Noboas disruptiver Regierungsstil ist neu und zumindest teilweise angelehnt an den von Präsident Nayib Bukele in El Salvador oder Donald Trump in den USA. Er ist leicht autoritär, ohne Kompromisse und ausgerichtet auf die momentan drei wichtigsten Themen für das Land: Sicherheit, Arbeitsplätze und Wirtschaft. Die Regierungskommunikation erfolgt fast ausschließlich über die sozialen Medien. Gegenüber zivilgesellschaftlichen und internationalen Akteuren ist Noboa skeptisch. Der Präsident regiert abgeschottet und agiert viel hinter den Kulissen. Er umgibt sich hauptsächlich mit engsten Vertrauten und ehemaligen Weggefährten, was sich in der Besetzung von Ministerämtern und wichtigen Positionen im Politikbetrieb widerspiegelt. Für viele politische und zivilgesellschaftliche Akteure bleibt der Zugang zu ihm schwierig. Dialog findet kaum statt.
Jedoch gehört es auch zu seiner Art des Regierens, dass Noboa keinem Konflikt aus dem Weg geht, sondern ihn vielmehr sucht, um als der Mann zu inszenieren, der dem organisierten Verbrechen die Stirn bietet. So beispielsweise, als er im Juli des vergangenen Jahres in Militärkleidung in Durán auftrat, einer ecuadorianischen Küstenstadt, die mit mehr als 140 gewaltsamen Toden im Jahr 2024 die gefährlichste Stadt Ecuadors und wohl auch der Welt war.3 Dort verkündete er populistisch und unter eindrucksvollen Bildern, dass man solange wie nötig hier bleibe, bis es mit den Mafias vorbei sei.
Ein anderes Beispiel ist sein rigoroses Handeln im Kontext eines diplomatischen Konflikts mit Mexiko. Das Land hatte dem rechtskräftig wegen Korruption verurteilten und flüchtigen ehemaligen Vizepräsidenten Rafael Correas, Jorge Glas, zunächst in seiner in Quito ansässigen Botschaft Zuflucht gewährt und dann angekündigt, diesem politisches Asyl zu gewähren. Daraufhin hatte Noboa aller diplomatischer Normen zum Trotz ein gewaltsames Eindringen in die Botschaft angeordnet und Glas verhaften und in ein Hochsicherheitsgefängnis bringen lassen.
Zwei Blöcke im neuen Parlament
Gemeinsam mit der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen wurden auch die Abgeordneten der Nationalversammlung für die Periode 2025-2028 gewählt. Analog zum Ergebnis wird es dort zwei große Blöcke geben, die Regierungspartei von Daniel Noboa, Acción Democrática Nacional (ADN) und den Correismo (Revolución Ciudadana, RC). Während ADN einen deutlichen Zuwachs auf 43,5 Prozent (im Vergleich zu 14,6 Prozent 2023) verzeichnete, hat RC mit 41,2 Prozent ein leicht besseres Ergebnis erzielt als im Jahr 2023 (39,7 Prozent). Nach ersten Ergebnissen kommt ADN auf mindestens 66 von 151 Abgeordneten, während auf RC 64 Mandate entfallen. Noboa schaffte es damit im Gegensatz zu 2023, weite Teile des durchaus heterogenen Anti-Correismo auch im Parlament hinter sich zu vereinen.
Die unterschiedlichen Lesarten des Ergebnisses setzen sich auch in der Parlamentszusammensetzung fort. Trotz eines leichten Zuwachses ist der Correismo erstmals überhaupt seit dem Beginn seiner Existenz 2007 nur zweitstärkste Kraft in der Nationalversammlung. Fast alle anderen politischen Bewegungen, beispielsweise das Movimento Construye des ermordeten Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio, die traditionsreiche Partido Social Cristiano, oder Creando Oportunidades des ehemaligen Staatspräsidenten Guillermo Lasso, kamen jeweils auf weniger als ein Prozent der Wählerstimmen.
Die neue Zusammensetzung in der Nationalversammlung spiegelt die große Polarisierung im Land wider. Die Anhänger von Daniel Noboa und Luisa González werden das parlamentarische Szenario bestimmen, während die restlichen Abgeordneten bei Abstimmungen das Zünglein an der Waage bilden werden. In Abwesenheit einer eigenen absoluten Mehrheit wird der Wahlsieger oder die Wahlsiegerin Kompromisse schließen müssen. Zudem darf zumindest ein Fragezeichen gesetzt werden, inwieweit die heterogene und neu aus verschiedenen Gruppen zusammengewürfelte ADN-Fraktion über die gesamte Zeit als Block erhalten bleiben wird.
Mehr als ungewiss bleibt auch die Qualität der neu gewählten Abgeordneten. Durch eine renommierte investigativ-journalistische Studie wurde zutage gebracht, dass gegen 236 der 2.089 Kandidaten für die Nationalversammlung in der Vergangenheit ein Strafverfahren eingeleitet worden war, oder sie sich aktuell einem gegenübersehen.4 Das entspricht 11% der aufgestellten Kandidatinnen und Kandidaten.
Eine Phase der Ungewissheit
Die im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Demokratien mit fast zwei Monaten lange Zeit zwischen der ersten und zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen erhöht die ohnehin große Ungewissheit über die Zukunft Ecuadors. Dies hat negative Auswirkungen auf die dringend notwendige Stabilisierung der politischen und wirtschaftlichen Situation, sowie die Fortsetzung des Kampfs gegen das organisierte Verbrechen und den Drogenhandel. Das Wahlergebnis dürfte nun zumindest kurzfristig für ein erhöhtes Länderrisiko Ecuadors sorgen, die Kreditwürdigkeit des Landes herabsetzen sowie den begonnenen wirtschaftlichen Erholungskurs und anstehende Investitionsvorhaben in Frage stellen. Wer in der sehr volatilen Gemengelage schlussendlich die Oberhand behalten wird, bleibt völlig offen. Aufgrund der hohen Polarisierung steht dem Land ein heißer und höchstwahrscheinlich auch schmutziger Wahlkampf bevor. Es ist zu befürchten, dass bei diesem auch die Gewalt eine Rolle spielen wird.
Gerade auch in der Außenpolitik stehen Noboa und González dabei für grundlegend unterschiedliche Weichenstellungen. Das zeigt etwa die Auseinandersetzung über den Umgang mit dem Maduro-Regime in Venezuela. Die Nichtanerkennung des Wahlsiegs des venezolanischen Oppositionskandidaten Edmundo González hat in Ecuador für große Empörung und auch Angst um einen Rückfall in den Correismo gesorgt. Noboa hatte sich in diesem Sinne klar für Edmundo González ausgesprochen, sowie diesen kürzlich in Quito empfangen und damit weiteren Rückhalt in der Bevölkerung bekommen. González hingegen distanzierte sich nicht von Rafael Correa, der für die Anerkennung des angeblichen Wahlsieges Maduros eintritt.
Für Europa und Deutschland wäre ein Sieg Noboas und eine damit verbundene vierjährige Amtszeit, eine große Chance, über eine Kooperation in Handels-, Wirtschafts- und Sicherheitsfragen einen stabilen Partner in der Andenregion gegenüber linksautoritären Systemen wie Kuba, Venezuela oder Nicaragua aufzubauen. Im Kampf gegen den Drogenhandel und die organisierte Kriminalität, insbesondere vor dem Hintegrund, dassi 70 Prozent aller Kokainexporte über ecuadorianische Häfen nach Europa gelangen, ist dies von besonderer Bedeutung. Die Europäische Hafeninitiative zur Verbesserung der Sicherheitsstandards und der Kontrolle an europäischen und lateinamerikanischen Häfen zum Kampf gegen Drogenhandel und organisierte Kriminalität könnten mit Ecuador weiter vertieft werden. In Bezug auf geopolitische Konstellationen wäre unter einer erneuten Amtszeit Noboas eine weitere Verschiebung der ecuadorianischen Prioritäten hin zu den USA und ihren Interessen zu erwarten, beispielsweise bei der Wiedereröffnung von US-Militärbasen in Ecuador, bei strategischer Kooperation im Kampf gegen das organisierte Verbrechen und der Reduzierung schulden- und kreditbedingter Abhängigkeiten gegenüber China.
Ein völlig anderes Szenario böte ein Rückfall des Landes in die Hände des Correismo. Auch wenn Luisa González sich außenpolitisch im Wahlkampf weitestgehend bedeckt hielt, stehen die internationalen Wortführer des Corrreismo fest an der Seite der „antiimperialistischen“ Linken der Region und halten enge Beziehungen nach Peking und Moskau. So ist der wegen seiner Menschenrechtsbilanz international kritisierte Ex-Machthaber Rafael Correa ein gern gesehener Gast in den Programmen des russischen Propagandasenders „Russia Today“. Die ecuadorianischen Wähler stehen somit auch außenpolitisch durchaus vor einer Grundsatzentscheidung.
Themen
Über diese Reihe
Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist in rund 110 Ländern auf fünf Kontinenten mit einem eigenen Büro vertreten. Die Auslandsmitarbeiter vor Ort können aus erster Hand über aktuelle Ereignisse und langfristige Entwicklungen in ihrem Einsatzland berichten. In den "Länderberichten" bieten sie den Nutzern der Webseite der Konrad-Adenauer-Stiftung exklusiv Analysen, Hintergrundinformationen und Einschätzungen.