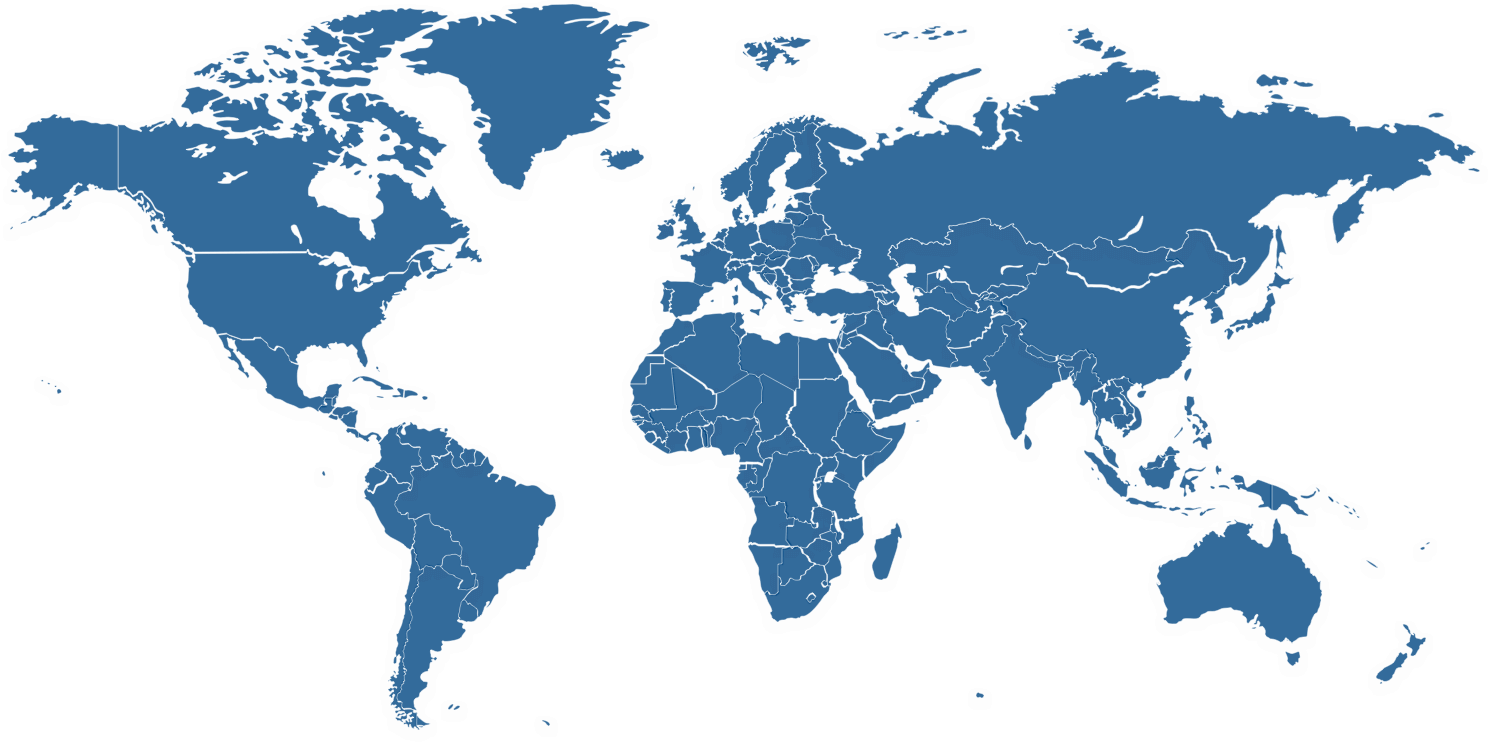Expert panel
Details
Bericht
Am 14. Oktober 2004 organisierte das Europabüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem European Policy Forum in Brüssel eine Veranstaltung zum Thema „Leistungen der Daseinsvorsorge“. Mit diesem Begriff bezeichnet die EU-Kommission Leistungen wie etwa Programme, welche die Bereitstellung allgemeiner Dienstleistungen sowie sozialer Versorgungseinrichtungen sicherstellen.
In diesem Jahr veröffentlichte die Kommission zu dieser Thematik ein „Weissbuch“ und wird im kommenden Jahr darüber entscheiden, ob sie einen Vorschlag für eine EU-Richtlinie einbringen wird. Zwischenzeitlich gibt die vorgeschlagene EU-Verfassung der EU in diesem Bereich neue Machtbefugnisse.
Das Treffen brachte Sichtweisen aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich zusammen. Die britische Perspektive vertraten Sir Ian Byatt, Jerry Cresswell (Head of Economic Regulation, Thames Water/RWE) und Christopher Barton (UKREP). Die deutsche Position wurde von Joachim Wuermeling (MdEP) und Dr. Wenzel von der Deutschen Ständigen Vertretung dargelegt. Herr Jacques Toubon (MdEP) gab Einblick in die französische Sichtweise hinsichtlich des Themas. Die Kommission wurde vom stellvertretenden Generalsekretär Moavero Milanesi repräsentiert. Im Anschluss an die Konferenz lud die Konrad-Adenauer-Stiftung zum Dinner mit dem zukünftigen Vizepräsidenten der EU-Kommission, Herr Jacques Barrot, ein.
Sensibilitäten im Bereich Dienstleistungssektor
Die Diskussion erstreckte sich über den gesamten Dienstleistungssektor und ging folglich sowohl auf Leistungen der Daseinsvorsorge als auch auf Vorschläge für Richtlinien zu nicht-ökonomischen Dienstleistungen, wie beispielsweise in sozialen Bereichen der Gesundheit und Bildung, ein. Eine Reihe von Sprechern hielt aufgrund bestehender Empfindlichkeiten der öffentlichen Meinung bezüglich dieser Themen zum vorsichtigen Vorgehen an und warnte vor „falschen“ Vergleichen. Ein Redner drängte darauf einzelne Leistungsuntereinheiten von einem Vorschlag für eine Dienstleistungsrichtlinie auszuschließen.
Subsidiarität
Aufgrund der hohen Empfindlichkeit, welche mit dieser Thematik einhergeht, wurde der Begriff „Subsidiarität“ sehr beansprucht. Daraus lässt sich erkennen, dass die EU verschiedene Formen der Bereitstellung von Dienstleistungen respektieren solle, zwischen verschiedenen Sektoren und Subsektoren zu unterscheiden habe, unterschiedliche Formen der Eigentümerschaft zulassen solle und lokale Präferenzen und regionale Zuständigkeiten zu respektieren habe. Ein Sprecher erinnerte daran, dass die Förderung des sozialen Zusammenhalts den Kontext für den Ursprung des Subsidiaritätsprinzips bildete. Die meisten Redner warnten vor jeglichen neuen horizontalen EU-Rahmenrichtlinien, die sämtliche Bereiche der Daseinsvorsorge abdecken würden.
Wettbewerbspolitik
Ein weiteres großes Thema der Diskussionsrunde war die Wettbewerbspolitik. Es wurde hervorgehoben, dass die britische Erfahrung gezeigt hatte, dass die Konsumenten von der Einführung von Wettbewerb in Leistungsbereiche, wie beispielsweise der Wasserversorgung, der Gesundheits- und der Bildungspolitik, profitierten. Liberalisierung und Wettbewerb seien mit dem Erreichen von sozialen Zielen zu vereinbaren. Einige Teilnehmer erinnerten daran, dass Wettbewerbspolitik eine von der gesamten EU verfolgte Politik sei und nun konsequent durchgesetzt werden sollte.
Vor allem bestünde die Notwendigkeit, Märkte, die aus dem einen oder anderen Grunde für Neueinsteiger verschlossen seien, zu öffnen. Darüber hinaus müsse die EU-Position zu staatlichen Hilfen klargestellt werden. Auch bestehe ein Unterschied zwischen liberalisierten Märkten, Marktzugang und Privatisierung.
Rechtssicherheit und ungleiche Implementierung
Es wurde angedeutet, dass trotz einiger gebietsrelevanter Urteile von Seiten des EuGH, noch viel Rechtsunsicherheit über die Anwendbarkeit von Wettbewerbspolitik bestehe, verglichen mit anderen Angelegenheiten, wie beispielsweise dem Subsidiaritätsprinzip. Unsicherheiten bestünden auch bezüglich der Frage, wie weit eine Marktöffnung im sozialen Bereich gehen sollte. In diesem Kontext wurde auf die ausgleichende Funktion unabhängiger Sektorenregulatoren eingegangen. In Bezug auf die eventuell geplanten Richtlinien wurde der Mangel an ausreichenden Folgeabschätzungen angesprochen.