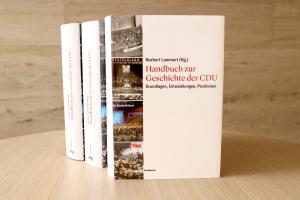Zu Beginn der Tagung begrüßte Dr. Michael Borchard, Leiter WD/ACDP der Konrad-Adenauer-Stiftung, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und wies darauf hin, dass die Rolle der Bundespräsidenten nur selten im Fokus des wissenschaftlichen und öffentlichen Interesses stehe.
In seinem Einführungsvortrag knüpfte Manfred Görtemaker daran an und erläuterte die Stellung des Bundespräsidenten im politischen System der Bundesrepublik als Gewalt sui generis. Am Ende fragte Görtemaker nach der Präsidentenmacht in Krisenzeiten und prognostizierte, dass der Bundespräsident vor dem Hintergrund der zunehmenden Parteienzersplitterung an Einfluss gewinnen werde. In der Diskussion wurde das Amt des Bundespräsidenten als machtpolitische Reserve sowie die verfassungspolitischen Kompetenzen anhand verschiedener Beispiele thematisiert.
Im ersten Panel standen Bundeskanzler Konrad Adenauer und sein Verhältnis zu Heuss sowie die sogenannte Präsidentschaftskrise von 1958/59 im Mittelpunkt. In seinem Vortrag ging Thorsten Holzhauser, wissenschaftlicher Referent der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus in Stuttgart, auf die Arbeitsteilung ein, die sich zwischen Adenauer und Heuss entwickelt habe. Die Ereignisse rund um den ersten Wechsel im Amt des Bundespräsidenten analysierte Jürgen Peter Schmied, wissenschaftlicher Referent am Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Nachdem Konrad Adenauer alle möglichen Nachfolger demontiert hatte, habe er seine eigene Kandidatur verkündet, zog sie später aber wieder zurück. Das habe Adenauers Autorität nachhaltig beschädigt.
Im zweiten Panel referierte Stefan Marx, Referent WD/ACDP über Heinrich Lübke als ersten christlichen Demokraten im Amt des Bundespräsidenten. Er zeichnete Lübke als einen Präsidenten, der sich in seiner ersten Amtszeit große Beliebtheit erworben habe, der aber in der der zweiten Amtszeit aus gesundheitlichen Gründen überfordert gewesen sei. Philip Rosin, Referent WD/ACDP zeigte, wie sich mit der Wahl Gustav Heinemanns am 5. März 1969 in den Worten des designierten Bundespräsidenten „ein Stück Machtwechsel“ vollzogen habe. Entscheidend sei dabei gewesen, dass die Unionsparteien das Mehrheitswahlsystem durchsetzen wollten, weil dieses Vorhaben die Annäherung der um ihre Existenz fürchtenden FDP an die SPD befördert habe.
Im dritten Panel wandte sich Andreas Grau, Referent WD/ACDP zunächst Karl Carstens und dessen Verhältnis zur CDU zu. Der Liberalkonservative Carsten sei alles andere als ein Parteimann gewesen, sondern habe sich dem übergeordneten Interesse des Staates verpflichtet gesehen. Von einem anderen Blickwinkel aus urteilte Matthias Oppermann, Leiter Zeitgeschichte der KAS, über Richard von Weizsäcker, dessen Parteienkritik aus dem Jahr 1992 er in den Blick nahm. Auch ihm sei es vor allem um das Gemeinwohl gegangen.
Im letzten Panel sprach Michael Borchard über Roman Herzogs „Ruck-Rede“. Sie sei als Weckruf an Regierende und Regierte gleichermaßen zu verstehen gewesen. Anschließend erörterte Ralph Bollmann, stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die Bundespräsidentschaftswahlen in der Amtszeit von Angela Merkel und zeigte dabei, dass ihr Taktieren nicht immer die von ihr gewünschten Ergebnisse brachte.
Am Ende der Tagung resümierte Horst Möller, der ehemalige Direktor des Instituts für Zeitgeschichte und emeritierter Professor an der Universität München, die Ergebnisse und kam zu dem Ergebnis, dass sich das Amt des Bundespräsidenten in den letzten 75 Jahren bewährt habe. Vor allem durch die Macht des Wortes könne der Bundespräsident auch eigene Akzente setzen.
Fachlich fundiert und verständlich formuliert: Gern halten wir Sie über Neuerscheinungen auf GESCHICHTSBEWUSST auf dem Laufenden. Hier können Sie sich für unseren E-Mail-Verteiler anmelden.